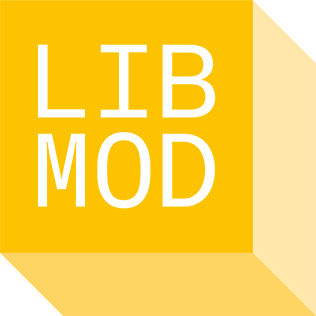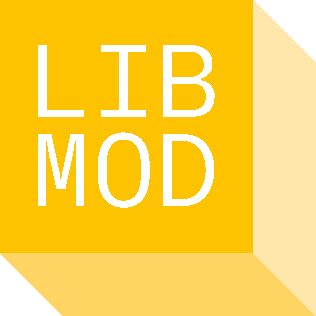„Schmiergelder als ‚Schlagbaum‘“

Presseschau ukrainischer Medien | 29. Oktober bis 11. November 2025:
Korruption: die Achillesferse des Präsidenten +++ Düstere Lage in Pokrowsk +++ Das seelische Leid der Kämpfenden
Korruption: die Achillesferse des Präsidenten
Es ist der größte innenpolitische Skandal des Jahres: Am Morgen des 10. November durchsuchte das Nationale Antikorruptionsbüro NABU das Haus von Timur Minditsch, einem langjährigen Geschäftspartner und Vertrauten von Präsident Selenskyj, der sich noch am selben Tag ins Ausland absetzte.
Gleichzeitig veröffentlichte NABU abgehörte Nachrichten, die Hinweise auf Korruption auf höchster Ebene beim staatlichen Atomkonzern Enerhoatom enthalten. Minditsch soll an der Spitze eines Systems gestanden haben, bei dem Gelder für den Bau von Schutzanlagen für Umspannwerke und andere von Russland ins Visier genommene Objekte teilweise unterschlagen wurden. Laut NABU wurden auf diesem Weg rund 100 Millionen US-Dollar gewaschen.
Beobachter:innen vermuten, dass genau diese Ermittlungen Präsident Selenskyj im Sommer zu harten Maßnahmen gegen die Antikorruptionsbehörden veranlasst haben könnten, die er nach öffentlichem Protest zurücknehmen musste. Inzwischen betont Selenskyj seine Unterstützung für die Ermittlungen und ordnete den Rücktritt von Energieministerin Switlana Hryntschuk und ihrem Amtsvorgänger Herman Haluschtschenko an.
„Schmiergelder als ‚Schlagbaum‘“
Liga analysiert die bisher veröffentlichten Mitschnitte:
„Das Antikorruptionsbüro berichtet, die Haupttätigkeit der kriminellen Organisation habe darin bestanden, systematisch unrechtmäßige Vorteile von Vertragspartnern von Enerhoatom in Höhe von 15 Prozent des Vertragswerts zu erschleichen.
Vertragspartner mussten [...] [anteilige] ‚Schmiergelder‘ abführen, damit Zahlungen für erbrachte Leistungen oder gelieferte Produkte nicht blockiert wurden oder sie ihren Lieferantenstatus aufrechterhalten konnten. Innerhalb des Unternehmens wurde diese Praxis als ‚Schlagbaum‘ bezeichnet, so [das Antikorruptionsbüro] NABU.
Um diesen Plan umzusetzen, zog der Anführer der Gruppe [Quellen zufolge: Tymur Minditsch] den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden des Staatsvermögensfonds [Ihor Myroniuk], der später Berater des Energieministers wurde, sowie einen ehemaligen Strafverfolgungsbeamten [...] hinzu [Dmytro Basov, früher Mitarbeiter der Generalstaatsanwaltschaft, derzeit Leiter der Sicherheitsabteilung von Enerhoatom].
NABU veröffentlichte einen Teil der mehr als 1.000 Stunden Audiomaterial umfassenden ‚Minditsch-Bänder‘, in denen drei Personen unter den Pseudonymen ‚Carlson‘, ‚Tenor‘ und ‚Rocket‘ auftreten. Unseren Quellen sowohl beim NABU als auch bei der [Sonderstaatsanwaltschaft zur Korruptionsbekämpfung] SAP zufolge verbergen sich hinter diesen Pseudonymen Minditsch, Basov und Myroniuk.“

„Nicht möglich ohne seinen Freund Wolodymyr Selenskyj“
Die Ukrajinska Prawda, die die Arbeit des NABU systematisch unterstützt, veröffentlichte wenige Tage vor den Enthüllungen vom 10. November ein ausführliches Porträt über Minditsch:
„Minditsch ist ein Name, der seit mehr als einem Jahr häufig in politischen Kreisen zu hören ist [im Zusammenhang mit dem für seine Regierungsnähe kritisierten landesweiten Nachrichtenprogramm Telethon; mit dem ehemaligen Vizepremier Oleksij Tschernyschow, der wegen Korruption angeklagt ist; mit Intransparenz bei der staatlichen Drohnenbeschaffung und der Raketenproduktion sowie bei den Themen Energie, Kabinett und Banken].
[Das ist] ein Mann, der sich offensichtlich vom jüngsten Partner und Verwalter der Medienvermögen des Oligarchen Ihor Kolomojskyj zu einem der heimlichen Drahtzieher im Land entwickelt hat.
Das wäre natürlich nicht möglich gewesen ohne seinen Freund Wolodymyr Selenskyj, der 2019 das wichtigste Amt des Landes […] übernahm. Und auch [nicht] ohne die groß angelegte Invasion Russlands, die demokratische Mechanismen in der Ukraine auf unbestimmte Zeit zum Erliegen brachte, darunter die Rechenschafts- und Transparenzpflicht der Regierung.“
„Wir haben großartige Institutionen aufgebaut“
Im Interview mit NV bewertet der Aktivist Vitalii Shabunin, der sich dem Kampf gegen Schattenwirtschaft und Korruption verschrieben hat, die Handlungsfähigkeit der ukrainischen Antikorruptionsbehörden als positives Signal:
„Wir als Gesellschaft können stolz sein. Wir haben starke Institutionen aufgebaut. Ich möchte daran erinnern, dass […] NABU und SAP erst wenig mehr als zehn Jahre alt sind. Sie haben während der Amtszeit des früheren Präsidenten Petro Poroschenko gegen dessen Team ermittelt und ermitteln jetzt gegen das Team des amtierenden Präsidenten. Leute, wir haben großartige Institutionen aufgebaut. […] in den USA leisten [seit Langem bestehende] Institutionen der amtierenden Regierung viel weniger Widerstand als unsere neuen Institutionen. Das ist ein gutes Zeichen.”
Düstere Lage in Pokrowsk
Die Kämpfe um Pokrowsk verschärfen sich: Trotz heftigen ukrainischen Widerstands gewinnt Russland langsam die Oberhand. Die Stadt steht zwar offiziell noch unter ukrainischer Kontrolle. Doch ohne feste Frontlinie und unter ständiger Bedrohung durch Drohnen und Artillerie wird jede Bewegung zum Risiko. Ukrainische Medien beschreiben die veränderte russische Taktik und sprechen von einem neuen Kapitel des Krieges.
„Kaum eine Chance zu entkommen“
Auf Basis zahlreicher anonymer Gespräche mit Soldat:innen zeichnet Hromadske-Frontkorrespondentin Diana Butsko ein düsteres Bild der Lage in der Stadt:
„‚Um es kurz zu machen: Pokrowsk und [das benachbarte] Myrnohrad sind verloren‘, sagt ein Pilot [...]. Er hat eigenständig seinen Posten in Pokrowsk verlassen, wo er 13 Tage diente. Dreimal musste sich seine Einheit in dieser Zeit zurückziehen, weil die Russen in der Stadt vorrücken. Seine Drohnen-Einheit befand sich [nur] 900 Meter vom Feind entfernt [...].
Nicht nur Soldat:innen direkt vor Ort [...] äußern pessimistische Prognosen [...], sondern auch Offiziere. ‚[...] Die Russen kontrollieren etwa 60 Prozent der Stadt. Der Feind steht auch in [den benachbarten Städten] Rodynske und Myrnohrad. Die Lage ist beschissen‘, sagt ein hochrangiger Offizier. [...]
Pokrowsk stand kurz vor der vollständigen Besetzung, nachdem Hunderte Russen in die Stadt eingedrungen waren. Das ukrainische Militär schaffte es nicht, die Lücken in der Verteidigung zu schließen, durch die der Feind seit dem Sommer in die Stadt kommt. Dies führte dazu, dass sich die Russen in Pokrowsk sammelten und [...] nun die gesamte ukrainische Garnison einzukesseln drohen.
‚Wer in Pokrowsk an vorderster Front steht, ist praktisch umzingelt und hat kaum eine Chance zu entkommen. Dort gibt es Häuser, Viertel und Straßen, durch die man kaum gehen kann, ohne erschossen zu werden‘, beschreibt besagter Pilot.”
„Die Russen tragen fast alle Zivil“
Der Militärexperte Oleksandr Kovalenko erklärt auf NV die veränderte Taktik der russischen Armee:
„In der Stadt wendet die russische Besatzungsarmee nun Taktiken an, bei denen sie keine vollwertigen Einheiten von Zug‑, Kompanie- oder Bataillonsgrößte einsetzt, sondern kleine Sabotage- und Aufklärungstrupps von zwei bis vier Mann, manchmal sogar nur einzelne Kämpfer. Dabei tragen sie in städtischen Gebieten fast alle Zivilkleidung, wodurch sie sich besser unter die Bevölkerung mischen können.
Natürlich trugen die russischen Besatzer auch in Bachmut, Awdijiwka und anderen Städten zivile Kleidung, aber nicht in diesem Ausmaß. Derzeit sind in Pokrowsk etwa 60 bis 70 Prozent der Besatzer in Zivil gekleidet. Das erschwert es, gegen sie vorzugehen, denn da sind ja auch noch [echte] Zivilisten anwesend.
Sie wollen außerdem gar nicht unbedingt in direkte Konfrontationen mit unseren [Streitkräften] gehen. Im Gegenteil: Sie versuchen, Feuerkontakt zu vermeiden. Sie haben die Aufgabe, so weit wie möglich in die Stadt vorzudringen. [...]
Darüber hinaus setzen die russischen Besatzungstruppen in Pokrowsk [mit Kameras ausgestattete] FPV-Drohnen mit minimaler Sprengkraft, aber maximaler Batterieleistung ein, die Gassen und Stadtviertel auskundschaften und die Stellungen der ukrainischen Verteidigungskräfte ausfindig machen. So können sie diese Stellungen nicht nur [leichter] angreifen, sondern die Sabotage- und Aufklärungstrupps, die in die Stadt eingedrungen sind, können sie auch gezielt umgehen.”
„Der Verlust wäre schmerzhaft, aber nicht fatal“
Weil Pokrowsk teilweise bereits eingekesselt ist und nach wie vor heftig angegriffen wird, nutzt die ukrainische Armee die Stadt nicht mehr als zentralen Logistikknotenpunkt. Wie sich die Lage entwickeln könnte, skizziert der Militärexperte Viktor Kevliuk vom Ukrainischen Zentrum für Verteidigungsstrategien auf LB:
„Vom ‚Fall von Pokrowsk‘ zu sprechen, ist verfrüht. Mit Waffenlieferungen und einer stabilisierten Logistik kann [die Stadt] weiter verteidigt werden und der Feind ist gezwungen, erhebliche Verluste zu erleiden (Hunderte pro Tag). Die weitere Verteidigung von Pokrowsk ist eine Investition in Zeit und Raum für Manöver, die nicht nur die Stadt, sondern die gesamte Ostfront schützt. Der Verlust der Stadt wäre ein schmerzhafter, wenn auch nicht fataler Schlag. Ihre Verteidigung stärkt hingegen die Position der Ukraine für künftige Gegenoperationen.“
Das seelische Leid der Kämpfenden
Ukrainische Soldat:innen kämpfen nicht nur physisch im Krieg, sondern leiden auch psychisch. Viele von ihnen berichten, wie schwer es ist, nach Monaten an der Front vom Rest der Gesellschaft verstanden zu werden. Ukrainische Medien beleuchten regelmäßig, mit welchen Belastungen die Kämpfenden leben, welche Unterstützung sie erhalten und was helfen könnte, die weniger sichtbaren Wunden des Krieges zu heilen.
„Ich spüre ständig diesen nationalen Schmerz“
Die ukrainische Kampfsanitäterin Alaska und ihre Kameradin Kuba wurden durch einen Dokumentarfilm landesweit bekannt. Auf Babel erzählt Alaska, wie es ihr nach all dem erlebten Schmerz geht:
„Ich empfinde kein Glück, aber solange ich kein Unglück empfinde, ist das schon in Ordnung. Denn wenn ich kein Glück empfinden kann, dafür aber auch keinen Schmerz, dann entscheide ich mich dafür, niemals Glück zu empfinden. Ich spüre ständig diese allgemeine nationale Katastrophe, diesen allgemeinen nationalen Schmerz. Ich sehe die Städte, in denen wir waren, und jetzt sind sie besetzt. Ich erinnere mich daran, dass es dort ein Café gab, in dem man Kaffee mit Kokosmilch bekam. Früher pflanzten die Menschen dort Blumen in den Hinterhöfen. Nichts davon gibt es mehr: Städte sterben, Menschen sterben. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich das überleben und akzeptieren kann. Ich sehe es mir an und möchte einfach nur heulen.“
„Was weg ist, ist weg“
Liga porträtiert den ukrainischen Veteranen Yevhenii Kholodnytskyi, der beide Arme und ein Auge verlor. Auf Tiktok zeigt er, wie er mit seinen neuen Prothesen und Einschränkungen lebt – und sie nicht mehr als Grenzen begreift:
„Ich bin ein einfacher Mensch, ich habe es so genommen: ‚Na schön, verdammt, jetzt habe ich eben keine Gliedmaßen mehr‘, sagt Kholodnytskyi. ‚Laufen kann ich noch, mein Verstand ist mir geblieben und ich kann noch sehen. Ein Mann muss das gelassen hinnehmen, darf nicht herumjammern, nicht weinen. Was weg ist, ist weg – es wächst ja nicht nach. Warum also leiden? Grob zusammengefasst, habe ich die Fähigkeit verloren, meine Schnürsenkel zu binden und Kreuzstich zu sticken. Alles andere mache ich ganz normal. Und gut, dann binde ich eben keine Schnürsenkel mehr – ich kaufe mir einfach Schuhe mit Gummizug.“
„In der Familie über den Krieg zu sprechen ist kein Tabu“
LB hat die Psychologin Ivanna Kovalchuk gefragt, wie Familien angehörigen Veteran:innen nahekommen und die Verbindung zu ihnen halten können:
„Mit einem Veteranen oder einer Veteranin in der Familie über Krieg und Kampfhandlungen zu sprechen, ist normal und kein Tabu, da Krieg ein großer und wichtiger Teil im Leben eines Soldaten oder einer Soldatin ist.
Aber es gibt Nuancen. Ivanna Kovalchuk sagt, […] wenn ein nahestehender Mensch, der aus dem Krieg zurückgekehrt ist, Details darüber mit der Familie teilen möchte, sollte man dem Raum geben. Aber es sei wichtig, wirklich dazu bereit zu sein. Wenn das nicht der Fall ist, sollte man das lieber offen ansprechen:
‚Wenn es Ihnen während so eines Gesprächs schlechter geht und Sie zum Beispiel anfangen zu weinen, könnte es auf die aus dem Krieg zurückgekehrte Person wirken, als tue sie mit ihren Handlungen oder Gesprächen einem nahestehenden Menschen weh. Dann kann es sein, dass sie sich verschließt und mit niemandem mehr über das Erlebte sprechen will […]. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, ob man selbst solche Schilderungen ertragen kann.‘
Es gibt Fälle, in denen Veteran:innen nicht über den Krieg sprechen. Das ist auch normal und bedeutet nicht, dass dadurch eine Kluft in der Familie entsteht oder das Vertrauen zueinander schwindet. Es kann eine Form des psychologischen Selbstschutzes sein, wenn eine Person nicht bereit ist, sich an traumatische Ereignisse zu erinnern. Oder der Versuch, die Familie vor traumatischen Informationen zu schützen.“
![]()
Ukrainische Medien
Die Online-Zeitung Ukrajinska Prawda veröffentlicht als regierungskritisches Medium investigative Artikel und deckte auch Korruptionsfälle innerhalb der ukrainischen Regierung auf. Sie zählt zu den meistgenutzten Nachrichtenportalen der Ukraine.
Die Ukrajinska Prawda wurde im Jahr 2000 vom ukrainisch-georgischen Journalisten Heorhij Gongadse gegründet, der im darauffolgenden Jahr – angeblich auf Veranlassung des damaligen Präsidenten Leonid Kutschma – ermordet wurde. Die heutige Chefredakteurin ist die bekannte ukrainisch-krimtatarische Journalistin Sevgil Musaieva.
Im Mai 2021 verkaufte die damalige Eigentümerin Olena Prytula 100 Prozent der Anteile an Dragon Capital, eine ukrainische Investment-Management-Gesellschaft, die vom tschechischen Unternehmer Tomáš Fiala geleitet wird.
Aufrufe der Website im Mai 2023: 69,6 Millionen
Das Online-Nachrichtenportal und ‑Fernsehen Hromadske finanziert sich über Crowdfunding bei seinen Leserinnen und Lesern, Spenden, Werbung und über für andere Medien aufgenommene Videos.
Hromadske wurde als NGO mit dazugehörigen Online-Medien im November 2013 mit Beginn des Euromaidan gegründet. Die jetzige Chefredakteurin ist die ukrainische Journalistin Jewhenija Motorewska, die sich zuvor mit dem Thema Korruption in ukrainischen Strafverfolgungsbehörden befasst hat.
Die Weiterentwicklung von Hromadske wird von einem Vorstand vorangetrieben, der aus sieben prominenten ukrainischen Persönlichkeiten besteht, darunter Nobelpreisträgerin Oleksandra Matwijtschuk.
Aufrufe der Website im Mai 2023: 2,8 Millionen
Der ukrainische Fernsehsender mit Online-Nachrichtenportal, dessen Chefredakteurin die ukrainische Journalistin Chrystyna Hawryljuk ist, wird finanziell von der ukrainischen Regierung unterstützt. In diesem Zusammenhang hat sich die Website einer ausgewogenen Berichterstattung verpflichtet.
Das renommierte Institute of Mass Information führte Suspilne.Novyny im September 2021 auf der sogenannten „weißen Liste“ ukrainischer Medien, die ein sehr hohes Niveau an zuverlässigen Informationen bieten.
Suspilne.Novyny wurde im Dezember 2019 gegründet und gehört zur Nationalen öffentlichen Rundfunkgesellschaft der Ukraine. Im Januar 2015 war die zuvor staatliche Rundfunkanstalt entsprechend europäischen Standards in eine öffentliche Rundfunkgesellschaft umgewandelt worden.
Aufrufe der Website im Mai 2023: 7,4 Millionen
NV ist eine Print- und Online-Zeitschrift, deren Schwerpunkt auf Nachrichten aus dem Ausland und der ukrainischen Politik liegt. Zu den Hauptthemen zählen die internationale Unterstützung der Ukraine, Korruption sowie die künftige Entwicklung des Landes. Die Online-Ausgabe veröffentlich oft Artikel renommierter ausländischer Medien wie The Economist, The New York Times, BBC und Deutsche Welle. Die Zeitschrift erscheint freitags als Druckausgabe auf Ukrainisch, die Website ist auf Ukrainisch, Russisch und Englisch verfügbar. NV gilt als eine der zuverlässigsten Nachrichtenquellen in der Ukraine.
NV wurde im Jahr 2014 – ursprünglich unter dem Namen Nowjoe Wremja („Die neue Zeit“) – vom ukrainischen Journalisten Witalij Sytsch gegründet, der die Chefredaktion übernahm. Zuvor arbeitete Sytsch bei dem ebenfalls populären Magazin Korrespondent. Er verließ Korrespondent, nachdem es an Serhij Kurtschenko – einen Janukowytsch nahestehenden Oligarchen aus Charkiw – verkauft worden war. NV gehört zum Verlagshaus Media-DK, dessen Eigentümer der tschechische Unternehmer Tomáš Fiala ist.
Aufrufe der Website im Mai 2023: 27,1 Millionen
Dserkalo Tyschnja liefert Hintergrundberichte und Analysen; das Themenspektrum umfasst politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Themen. Die Zeitung betrachtet die ukrainische Politik und deren Akteure in einem internationalen Zusammenhang. Dserkalo Tyschnja steht auf der „weißen Liste“ ukrainischer Medien, die zuverlässige Informationen liefern.
Dserkalo Tyschnja ist eine der ältesten ukrainischen Zeitungen und erschien zuerst 1994. Seit 2020 ist die Zeitung nur noch online verfügbar: auf Ukrainisch, Russisch und Englisch. Chefredakteurin ist die bekannte ukrainische Journalistin Julija Mostowa, Ehefrau des ehemaligen ukrainischen Verteidigungsministers Anatolij Hrysenko.
Aufrufe der Website im Mai 2023: 4,7 Millionen
Das ukrainische Online-Magazin Babel wurde im September 2018 gegründet. Das Themenspektrum umfasst soziale und politische Themen; besonderes Augenmerk gilt aber auch Nachrichten aus der Wissenschaft und über neue Technologien.
Nach dem 24. Februar 2022 wurde die zuvor ebenfalls angebotene russische Version der Website geschlossen. Stattdessen wird nun eine englische Version angeboten. Babel finanziert sich über Spenden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Babel engagieren sich in zahlreichen Projekten, die darauf abzielen, die ukrainischen Streitkräfte während des Krieges zu unterstützen.
Die Eigentümer des Online-Magazins sind der erste Chefredakteur Hlib Husjew, Kateryna Kobernyk und das slowakische Unternehmen IG GmbH.
Heute ist die ukrainische Journalistin Kateryna Kobernyk Chefredakteurin von Babel.
Aufrufe der Website im Mai 2023: 1,1 Millionen
Das Online-Magazin LB gehört zum Horschenin-Institut, einer ukrainischen Denkfabrik, die sich mit politischen und gesellschaftlichen Prozessen in der Ukraine und der Welt beschäftigt. LB hat sich auf Interviews spezialisiert; häufige Themen sind die ukrainische Innen- und internationale Politik sowie soziale Fragen in der Ukraine.
LB wurde im Juni 2009 unter dem Namen Liwyj Bereh gegründet, Chefredakteurin Sonja Koschkina hat seit 2018 einen eigenen Youtube-Kanal „KishkiNA“, auf dem sie Interviews mit verschiedenen Personen veröffentlicht.
Aufrufe der Website im Mai 2023: 2 Millionen
Im Fokus des ukrainischen im Jahr 2000 gegründeten Online-Nachrichtenportals LIGA stehen wirtschaftliche, politische und soziale Themen. Seit 2020 steht LIGA auf der „weißen Liste“ ukrainischer Medien, die stets präzise Informationen und zuverlässige Nachrichten anbieten.
Chefredakteurin ist die ukrainische Journalistin Julija Bankowa, die davor eine leitende Position bei dem Online-Magazin Hromadske hatte.
Der Eigentümer des Nachrichtenportals ist die ukrainische unabhängige Mediaholding Ligamedia, deren Geschäftsführer Dmytro Bondarenko ist.
Aufrufe der Website im Mai 2023: 8,5 Millionen
Censor präsentiert sich als Website mit „emotionalen Nachrichten“. Der Fokus liegt vor allem auf innenpolitischen Entwicklungen. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine sind viele Beiträge den Ereignissen an der Front und den ukrainischen Streitkräften gewidmet. Censor ist auf drei Sprachen verfügbar: Ukrainisch, Russisch und Englisch.
Das Nachrichtenportal Censor wurde 2004 vom bekannten ukrainischen Journalisten Jurij Butusow gegründet und zählt zu den populärsten Nachrichtenseiten des Landes. Butusow gilt als scharfer Kritiker von Präsident Selenskyj. Er erhebt schwere Vorwürfe in Bezug auf Korruption innerhalb der ukrainischen Regierung, schlechte Vorbereitung auf den Krieg gegen Russland und unbefriedigende Verwaltung der Armee. Butusow wird von über 400.000 Menschen auf Facebook gelesen. Seine Posts auf dem sozialen Netzwerk haben enormen Einfluss und lösen hitzige Diskussionen aus.
Aufrufe der Website im Mai 2023: 59 Millionen
Newsletter bestellen
Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.