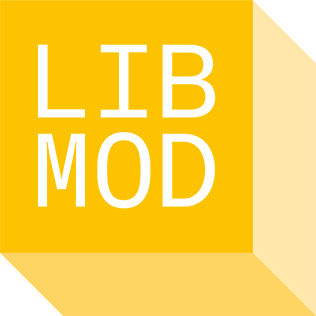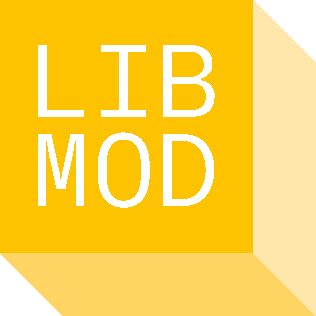„Moskau hat dem Mörder die Pistole in die Hand gelegt“

Presseschau ukrainischer Medien | 20. August bis 2. September 2025:
Schock über Mord an Ex-Parlamentspräsident Parubij +++ Polen distanziert sich +++ Drohnenangriffe auf die Druschba-Pipeline
Schock über Mord an Ex-Parlamentspräsident Parubij
Der ukrainische Politiker Andrij Parubij wurde am 30. August in Lwiw auf offener Straße erschossen. Wenig später nahmen die Behörden den mutmaßlichen Attentäter fest, der den Mord gegenüber Journalist:innen gestand. Andrij Parubij hatte sich schon zu Sowjetzeiten für eine unabhängige Ukraine eingesetzt und die Politik nach deren Zerfall geprägt wie kaum ein anderer. Er war eine der Leitfiguren der Orangenen Revolution 2004 und organisierte während der Maidan-Proteste 2013/14 die freiwillige Selbstverteidigung. Von 2016 bis 2019 war Parubij Parlamentspräsident. Die Nachricht von der Ermordung des 54-Jährigen löste landesweit Schock und Trauer aus. Hunderte Menschen nahmen an seiner Beisetzung am 2. September in Lwiw teil. Ukrainische Medien erinnern an den Politiker und äußern Vermutungen über die Hintergründe des sorgfältig geplanten Mordanschlags.
„Ein Abgeordneter europäischen Zuschnitts“
Parubij sei einer der wenigen bescheidenen und aufrichtigen Politiker gewesen, beschreibt LB:
„Für Parubij stand die Ukraine immer an erster Stelle. Wollte man das Wort ‚Patriot‘ mit einem einzigen Foto illustrieren, wäre es sicher seines. […] [Die Parlamentskorrespondentin Anna Steshenko erinnert sich:] „Er hat viel geraucht und redete mit uns Journalist:innen immer von Mensch zu Mensch, auf Augenhöhe. Das klingt seltsam, aber meine Kolleg:innen werden mich verstehen. Er erlaubte sich nie Sachen wie die Abgeordneten der Kommunisten oder der [einst prorussischen] Partei der Regionen. Er gab stets fachkundige Kommentare ab. Machte sich jedes Mal Sorgen, nicht rechtzeitig zur Abstimmung zu kommen – er war sehr verantwortungsbewusst. Mit anderen Worten: Er war ein Abgeordneter europäischen Zuschnitts.“
„Sein ganzes Leben lang auf den Krieg mit Russland vorbereitet“
Im Gespräch mit Suspilne erinnert sich die Abgeordnete Viktoriia Siumar an Parubij:
„2014 kamen wir gemeinsam [als Abgeordnete] der Partei Volksfront ins Parlament. Für uns war das Gesetz zur Dekommunisierung enorm wichtig. Später, als Parlamentspräsident, trieb [Parubij] viele Umbenennungen voran. [Im Rahmen der Dekommunisierung wurden in der Ukraine nach 2014 massenweise kommunistische und russlandbezogene Ortsnamen entfernt.] Er hat mich immer sehr unterstützt: bei meinen Gesetzen zum Verbot russischer Filme, zur Sprache im Bildungswesen, zu Quoten für ukrainische Lieder [im Radio] oder die [ukrainische] Sprache im Fernsehen […].
[Parubij] hat immer gesagt: ‚Mein ganzes Leben lang habe ich mich auf den Krieg mit Russland vorbereitet.‘ Er wusste, dass die Russen der Ukraine die Eigenstaatlichkeit nicht schenken würden, und verstand, dass man dafür kämpfen muss. Sein Wirken war Teil dieses großen Kampfes.“
„Moskau hat dem Mörder die Pistole in die Hand gelegt“
NV veröffentlicht einen Beitrag der Abgeordneten Iryna Herashchenko, die den russischen Staat für den Mord an Parubij verantwortlich macht:
„Berichten von Medien und ihren Quellen in den Strafverfolgungsbehörden zufolge war der Mörder der Vater eines Freiwilligen, der als im Krieg vermisst galt. Um den Leichnam seines Sohnes [aus Russland] zu erhalten, willigt er in den Mord ein. Ein Mensch aus einem patriotischen, proukrainischen Umfeld wird in seiner Verzweiflung vom [russischen Inlandsgeheimdienst] FSB angeworben und begeht ein schreckliches Verbrechen.
Russland ist ein verrottetes Land. Es tötet uns an der Front und von innen heraus. Es nutzt die Methoden des [kommunistischen Geheimdienstes] NKWD, der die Menschen während des Holodomors [der bewusst herbeigeführten Hungersnot 1932/33] und in den stalinistischen Lagern zum Verlust ihrer Menschlichkeit und zum Kannibalismus trieb. Der NKWD hat unseren Helden in den Hinterkopf geschossen. Und [jetzt hat] Moskau dem Mörder [Parubyjs] die Pistole in die Hand gelegt – ganz nach dem Vorbild des NKWD. Nichts Neues.
Ein Terrorstaat, der von ‚Entnazifizierung‘ spricht, aber in Wahrheit die Zerstörung der ukrainischen Identität und ihrer Menschen […] anstrebt und gleich zu Beginn des Krieges Erschießungslisten [mit den Namen] ukrainischer Staatsbediensteter erstellte, um all jene zu vernichten, die ukrainisches Gedankengut in sich tragen. Der Mord an Andrij ist ein Schuss in Geist und Herz des Maidan, er verkörperte wie kein anderer unseren Protest und [unseren] Kampf für die Freiheit.“
„Die Blutgier des russischen Pöbels stillen“
Der Militärbeobachter Oleksandr Kovalenko warnt bei NV vor einer neuen russischen Taktik:
„Es entsteht der Eindruck, die russischen Geheimdienste hätten sich für das Szenario entschieden, bekannte Führungsfiguren der ukrainischen Demokratie- und Freiheitsbewegung früherer Zeit zu vernichten – Menschen, die heute auf der politischen Bühne keine [besondere] Rolle mehr spielen, deren Ermordung jedoch die Raubtierinstinkte [der Russen] weckt.
Das ist eine äußerst negative Tendenz. Denn de facto geraten damit alle in die Schusslinie, die an der Revolution der Würde [2013/14] teilgenommen haben – insgesamt eine ziemlich lange Liste potenzieller Opfer.
Solche Morde verändern natürlich weder den Verlauf der Kampfhandlungen noch wirken sie sich sonst irgendwie auf das umkämpfte Gebiet aus. Vielmehr sollen sie das Ausbleiben spektakulärer Siege an der Front ausgleichen, in dem sie punktuell die Blutgier des russischen Pöbels stillen. Werden sie versuchen, das Scheitern der Sommeroffensive durch die Ermordung bekannter ukrainischer Patrioten auszugleichen? Offensichtlich ja.“
Polen distanziert sich
Am 25. August legte Polens neu gewählter Präsident Karol Nawrocki sein Veto gegen Gesetze ein, die die finanzielle Unterstützung für ukrainische Kriegsflüchtlinge verlängert hätten. Gewählt für seine nationalistischen und ukrainekritischen Parolen, verkörpert Nawrocki eine zunehmend kühle Haltung gegenüber dem östlichen Nachbarn, die in Polen an Boden gewinnt.
„Die Botschaft ist klar: Ukrainer, haut ab!“
LB schildert, wie sich die Einstellung der polnischen Gesellschaft gegenüber ukrainischen Geflüchteten seit Nawrockis Wahlkampf spürbar verändert hat:
„Etwa 992.500 ukrainische Staatsbürger:innen leben derzeit […] in Polen, einem Land mit 36 Millionen Einwohner:innen. Das sind 23 Prozent aller Ukrainer:innen in der EU – mehr leben nur in Deutschland (etwa 1,2 Millionen). Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Polen ist kulturell und geografisch nah und war noch vor drei Jahren sehr offen gegenüber Ukrainer:innen.
Kurz vor den Präsidentschaftswahlen änderte sich die Situation jedoch, als bestimmte politische Gruppen beschlossen, die ‚ukrainische Frage‘ prominent auf die innenpolitische Agenda zu setzen. Selbst die Präsidentschaftskandidaten diskutierten über den [rechtlichen] Status der Ukrainer:innen, wobei sich drei der fünf Spitzenkandidaten […] negativ über unsere Landsleute äußerten.
Ende Juli fanden unter dem Motto ‚Polen den Polen‘ migrationsfeindliche Kundgebungen in 80 polnischen Städten statt. Es wurde zwar nicht ausdrücklich gesagt, dass sich das gegen Ukrainer:innen richtete, aber die Botschaft war klar – zum Beispiel für die Regisseurin und Schriftstellerin Iryna Tsilyk. ‚Als ich mit meinem Sohn durch eine schöne, alte polnische Stadt spazierte, sahen wir plötzlich ein Graffito an der Wand: Ukrainer, haut ab!‘, schilderte sie auf Facebook.
Wenn Präsident Karol Nawrocki heute an seinen Wahlkampfslogan ‚Polen zuerst […]‘ erinnert, versteht man ihn genau so.“
„Bedrohung statt Stabilität für ukrainische Frauen“
Die Ukrajinska Prawda berichtet über einen offenen Brief prominenter Polinnen gegen den Kurs des Präsidenten:
„‚Stellen Sie sich vor, Sie sind im Krieg – und ein Nachbarland behandelt Ihre Frauen und Kinder wie politische Geiseln‘, heißt es in dem Appell […].
Statt [in Polen] Stabilität [zu finden], fürchteten ukrainische Frauen, erneut fliehen zu müssen und hätten das Vertrauen in den polnischen Staat verloren, so die Autorinnen des Schreibens.
‚Wir, polnische Frauen – Mütter, Ehefrauen, Töchter, Schwestern und Großmütter – sagen ganz klar: Niemand hat das Recht, in unserem Namen Bedingungen an Frauen zu stellen, die vor einem Krieg fliehen. Wir akzeptieren nicht, dass der Schmerz und das Leid von Menschen, die unsere Unterstützung brauchen, zum Zündstoff für Streitigkeiten gemacht werden. Wir werden nicht zulassen, dass das Vertrauen zerstört wird, auf dem unsere Gemeinschaft beruht.‘“
„Eine wichtige Lehre für die Zukunft“
Die NV-Journalistin Olha Dukhnich warnt vor dem selbstzerstörerischen, migrationsfeindlichen Populismus in Polen, der eines Tages auch in der Ukraine aufbrechen könnte:
„Häufig ist es die ineffektive Innenpolitik dieser Länder im Bildungs- und Gesundheitswesen oder bei der Altersvorsorge, die die Suche nach einem Sündenbock auslöst – und Schuld sind dann die Migrant:innen. Dazu trägt auch bei, dass die Menschen in mittel- und osteuropäischen Ländern traditionell wenig Vertrauen in den Staat haben. Wenn Du mit der Politik unzufrieden bist und Vertrauen in den Staat hast, dann adressierst Du Deine Kritik an den Staat – wenn Du aber kein Vertrauen hast, suchst Du nach jemandem, der den Brunnen vergiftet hat‘. […] Migrant:innen sind immer ein leichtes Ziel, weil sie fremd sind. […]
Migrationsfeindliche Stimmungen […] sind oft das Ergebnis einer Kombination von Faktoren, in denen sich eine Nation nicht mehr wiedererkennt. Das erleben wir auch in Polen: Wirtschaftlich braucht das Land dringend Migrant:innen, politisch aber spielt es mit selbstzerstörerischem Populismus. Das ist auch für uns eine wichtige Lehre für die Zukunft.“
Drohnenangriffe auf die Druschba-Pipeline
Ukrainische Drohnen haben im Westen Russlands erneut die Öl-Pipeline Druschba (dt. Freundschaft) angegriffen. Einst war die mehrere tausend Kilometer lange Pipeline Symbol sowjetischer Größe, heute übt Russland über die Öl-Lieferungen Druck auf die Slowakei und Ungarn aus. Besonders der ungarische Regierungschef Viktor Orbán pflegt das Image des ewigen Frenemy Kyjiws, blockiert regelmäßig Hilfen und die EU-Integration der Ukraine. Können die Angriffe auf die Pipeline das ändern?
„Fesseln statt Freundschaft“
Die mit der Ukrajinska Prawda verbundene Jewropejska Prawda beschreibt, wie die Pipeline zu einem Instrument geopolitischen Drucks geworden ist:
„Sowjetische Ideologen zeigten sich einfallsreich bei der Namensgebung für die großen Gas- und Ölpipelines, die die Vorkommen in Sibirien mit den Ländern Ost- und Mitteleuropas verbanden. Das erste System nannten sie ‚Bruderschaft‘, das zweite ‚Freundschaft‘.
Im 21. Jahrhundert erinnert die Öl-Pipeline ‚Freundschaft‘ jedoch immer weniger an ein Symbol der Partnerschaft, sondern vielmehr an Fesseln, die der Kreml seinen ‚besonderen Freunden‘ in Europa angelegt hat. Wie kommt es, dass die ungarische Regierung […] nach mehr als dreieinhalb Jahren großangelegtem Krieg weiter auf die russische ‚Freundschaft‘ setzt? Statt verstärkt in die Diversifizierung der Versorgungswege zu investieren, bleibt Budapest starrsinnig eine Geisel seiner Abhängigkeit – und schlägt daraus auch noch politisches Kapital.
Schon vorübergehende Unterbrechungen der Lieferungen durch die [Öl-Pipeline] ‚Freundschaft‘ zeigen die Anfälligkeit gegenüber russischen Energieressourcen. Das liefert der EU ein weiteres Argument, den Druck zu verstärken und den endgültigen Verzicht auf russisches Öl zu erzwingen […].“
„Druckmittel gegen Orbán“
Forbes sieht in den Angriffen ein Mittel, um Ungarn zur Kooperation mit Kyjiw zu bewegen:
„Trump rief Orbán an, nachdem er sich am 18. August im Weißen Haus mit Selenskyj und europäischen Spitzenpolitiker:innen getroffen hatte. […] Er habe Orbán angeblich davon überzeugen können, den Weg der Ukraine in die EU nicht weiter zu blockieren. […]
Die Angriffe auf die Druschba-Pipeline seien eher ein paralleler Prozess dazu […], so ein Gesprächspartner aus diplomatischen Kreisen. Die ukrainische Führung habe schon lange versucht, die Ölpipeline […] als Druckmittel gegenüber Orbán einzusetzen. Seit die USA einbezogen seien, um die Blockadehaltung Ungarns gegenüber der ukrainischen EU-Integration aufzulösen, scheine sich dafür ein Fenster der Gelegenheit geöffnet zu haben. Nach vier Angriffen auf die Druschba haben jedenfalls weder die USA noch die EU dies gegenüber der Ukraine öffentlich kritisiert.
Könnten die Angriffe auf die Pipeline den diplomatischen Fortschritt auch zunichte machen? Trotz der scharfen Rhetorik von [Ungarns Außenminister Péter] Szijjártó gehe der diplomatische Prozess weiter, wie der Besuch [des ukrainischen Vizepremier Taras] Katshka [in Budapest Ende August] zeige, ist [Vitalii] Diatchuk vom [ukrainischen Thinktank] Institute of Central European Strategy überzeugt.
‚Der Besuch Katshkas war bereits vor den Angriffen geplant‘, betont der Gesprächspartner aus diplomatischen Kreisen [gegenüber Forbes]. ‚Er wird die Botschaft übermitteln: Einigen wir uns [und blockieren die EU-Integration der Ukraine nicht weiter].‘“
![]()
Ukrainische Medien
Die Online-Zeitung Ukrajinska Prawda veröffentlicht als regierungskritisches Medium investigative Artikel und deckte auch Korruptionsfälle innerhalb der ukrainischen Regierung auf. Sie zählt zu den meistgenutzten Nachrichtenportalen der Ukraine.
Die Ukrajinska Prawda wurde im Jahr 2000 vom ukrainisch-georgischen Journalisten Heorhij Gongadse gegründet, der im darauffolgenden Jahr – angeblich auf Veranlassung des damaligen Präsidenten Leonid Kutschma – ermordet wurde. Die heutige Chefredakteurin ist die bekannte ukrainisch-krimtatarische Journalistin Sevgil Musaieva.
Im Mai 2021 verkaufte die damalige Eigentümerin Olena Prytula 100 Prozent der Anteile an Dragon Capital, eine ukrainische Investment-Management-Gesellschaft, die vom tschechischen Unternehmer Tomáš Fiala geleitet wird.
Aufrufe der Website im Mai 2023: 69,6 Millionen
Das Online-Nachrichtenportal und ‑Fernsehen Hromadske finanziert sich über Crowdfunding bei seinen Leserinnen und Lesern, Spenden, Werbung und über für andere Medien aufgenommene Videos.
Hromadske wurde als NGO mit dazugehörigen Online-Medien im November 2013 mit Beginn des Euromaidan gegründet. Die jetzige Chefredakteurin ist die ukrainische Journalistin Jewhenija Motorewska, die sich zuvor mit dem Thema Korruption in ukrainischen Strafverfolgungsbehörden befasst hat.
Die Weiterentwicklung von Hromadske wird von einem Vorstand vorangetrieben, der aus sieben prominenten ukrainischen Persönlichkeiten besteht, darunter Nobelpreisträgerin Oleksandra Matwijtschuk.
Aufrufe der Website im Mai 2023: 2,8 Millionen
Der ukrainische Fernsehsender mit Online-Nachrichtenportal, dessen Chefredakteurin die ukrainische Journalistin Chrystyna Hawryljuk ist, wird finanziell von der ukrainischen Regierung unterstützt. In diesem Zusammenhang hat sich die Website einer ausgewogenen Berichterstattung verpflichtet.
Das renommierte Institute of Mass Information führte Suspilne.Novyny im September 2021 auf der sogenannten „weißen Liste“ ukrainischer Medien, die ein sehr hohes Niveau an zuverlässigen Informationen bieten.
Suspilne.Novyny wurde im Dezember 2019 gegründet und gehört zur Nationalen öffentlichen Rundfunkgesellschaft der Ukraine. Im Januar 2015 war die zuvor staatliche Rundfunkanstalt entsprechend europäischen Standards in eine öffentliche Rundfunkgesellschaft umgewandelt worden.
Aufrufe der Website im Mai 2023: 7,4 Millionen
NV ist eine Print- und Online-Zeitschrift, deren Schwerpunkt auf Nachrichten aus dem Ausland und der ukrainischen Politik liegt. Zu den Hauptthemen zählen die internationale Unterstützung der Ukraine, Korruption sowie die künftige Entwicklung des Landes. Die Online-Ausgabe veröffentlich oft Artikel renommierter ausländischer Medien wie The Economist, The New York Times, BBC und Deutsche Welle. Die Zeitschrift erscheint freitags als Druckausgabe auf Ukrainisch, die Website ist auf Ukrainisch, Russisch und Englisch verfügbar. NV gilt als eine der zuverlässigsten Nachrichtenquellen in der Ukraine.
NV wurde im Jahr 2014 – ursprünglich unter dem Namen Nowjoe Wremja („Die neue Zeit“) – vom ukrainischen Journalisten Witalij Sytsch gegründet, der die Chefredaktion übernahm. Zuvor arbeitete Sytsch bei dem ebenfalls populären Magazin Korrespondent. Er verließ Korrespondent, nachdem es an Serhij Kurtschenko – einen Janukowytsch nahestehenden Oligarchen aus Charkiw – verkauft worden war. NV gehört zum Verlagshaus Media-DK, dessen Eigentümer der tschechische Unternehmer Tomáš Fiala ist.
Aufrufe der Website im Mai 2023: 27,1 Millionen
Dserkalo Tyschnja liefert Hintergrundberichte und Analysen; das Themenspektrum umfasst politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Themen. Die Zeitung betrachtet die ukrainische Politik und deren Akteure in einem internationalen Zusammenhang. Dserkalo Tyschnja steht auf der „weißen Liste“ ukrainischer Medien, die zuverlässige Informationen liefern.
Dserkalo Tyschnja ist eine der ältesten ukrainischen Zeitungen und erschien zuerst 1994. Seit 2020 ist die Zeitung nur noch online verfügbar: auf Ukrainisch, Russisch und Englisch. Chefredakteurin ist die bekannte ukrainische Journalistin Julija Mostowa, Ehefrau des ehemaligen ukrainischen Verteidigungsministers Anatolij Hrysenko.
Aufrufe der Website im Mai 2023: 4,7 Millionen
Das ukrainische Online-Magazin Babel wurde im September 2018 gegründet. Das Themenspektrum umfasst soziale und politische Themen; besonderes Augenmerk gilt aber auch Nachrichten aus der Wissenschaft und über neue Technologien.
Nach dem 24. Februar 2022 wurde die zuvor ebenfalls angebotene russische Version der Website geschlossen. Stattdessen wird nun eine englische Version angeboten. Babel finanziert sich über Spenden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Babel engagieren sich in zahlreichen Projekten, die darauf abzielen, die ukrainischen Streitkräfte während des Krieges zu unterstützen.
Die Eigentümer des Online-Magazins sind der erste Chefredakteur Hlib Husjew, Kateryna Kobernyk und das slowakische Unternehmen IG GmbH.
Heute ist die ukrainische Journalistin Kateryna Kobernyk Chefredakteurin von Babel.
Aufrufe der Website im Mai 2023: 1,1 Millionen
Das Online-Magazin LB gehört zum Horschenin-Institut, einer ukrainischen Denkfabrik, die sich mit politischen und gesellschaftlichen Prozessen in der Ukraine und der Welt beschäftigt. LB hat sich auf Interviews spezialisiert; häufige Themen sind die ukrainische Innen- und internationale Politik sowie soziale Fragen in der Ukraine.
LB wurde im Juni 2009 unter dem Namen Liwyj Bereh gegründet, Chefredakteurin Sonja Koschkina hat seit 2018 einen eigenen Youtube-Kanal „KishkiNA“, auf dem sie Interviews mit verschiedenen Personen veröffentlicht.
Aufrufe der Website im Mai 2023: 2 Millionen
Im Fokus des ukrainischen im Jahr 2000 gegründeten Online-Nachrichtenportals LIGA stehen wirtschaftliche, politische und soziale Themen. Seit 2020 steht LIGA auf der „weißen Liste“ ukrainischer Medien, die stets präzise Informationen und zuverlässige Nachrichten anbieten.
Chefredakteurin ist die ukrainische Journalistin Julija Bankowa, die davor eine leitende Position bei dem Online-Magazin Hromadske hatte.
Der Eigentümer des Nachrichtenportals ist die ukrainische unabhängige Mediaholding Ligamedia, deren Geschäftsführer Dmytro Bondarenko ist.
Aufrufe der Website im Mai 2023: 8,5 Millionen
Censor präsentiert sich als Website mit „emotionalen Nachrichten“. Der Fokus liegt vor allem auf innenpolitischen Entwicklungen. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine sind viele Beiträge den Ereignissen an der Front und den ukrainischen Streitkräften gewidmet. Censor ist auf drei Sprachen verfügbar: Ukrainisch, Russisch und Englisch.
Das Nachrichtenportal Censor wurde 2004 vom bekannten ukrainischen Journalisten Jurij Butusow gegründet und zählt zu den populärsten Nachrichtenseiten des Landes. Butusow gilt als scharfer Kritiker von Präsident Selenskyj. Er erhebt schwere Vorwürfe in Bezug auf Korruption innerhalb der ukrainischen Regierung, schlechte Vorbereitung auf den Krieg gegen Russland und unbefriedigende Verwaltung der Armee. Butusow wird von über 400.000 Menschen auf Facebook gelesen. Seine Posts auf dem sozialen Netzwerk haben enormen Einfluss und lösen hitzige Diskussionen aus.
Aufrufe der Website im Mai 2023: 59 Millionen
Newsletter bestellen
Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.