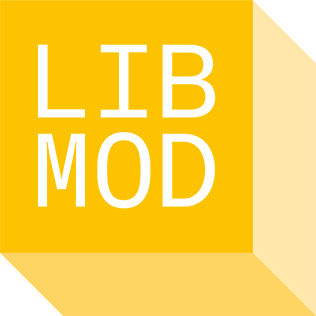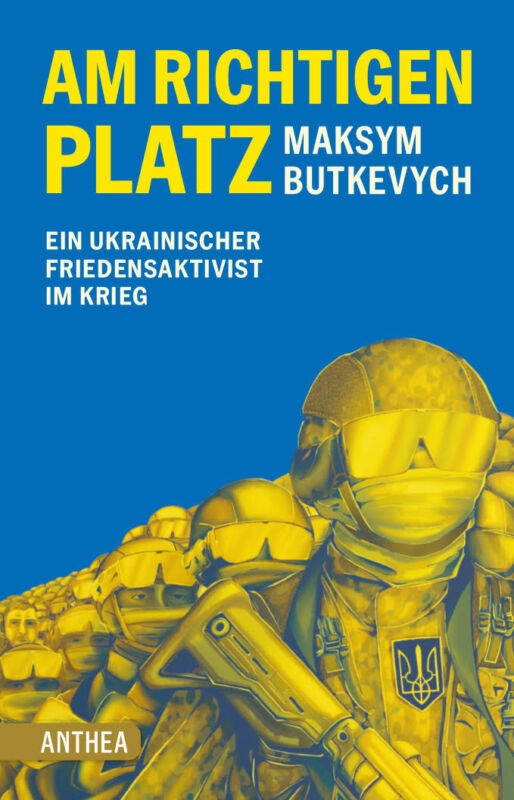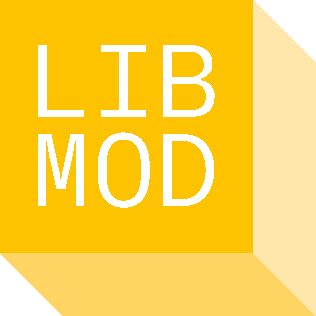„Ein ukrainischer Friedensaktivist im Krieg“

Der ukrainische Menschenrechtler Maksym Butkevych trat kurz nach Beginn der Großinvasion freiwillig den ukrainischen Streitkräften bei und geriet in russische Kriegsgefangenschaft. Wenige Tage vor seiner Freilassung im Oktober dieses Jahres erschien im Anthea Verlag eine Sammlung seiner Texte. Eine Rezension von Yelizaveta Landenberger.
Maksym Butkevych wurde 1977 in Kyjiw geboren und wollte als kleiner Junge unbedingt Kosmonaut werden. Dieser Karriereweg scheiterte aus gesundheitlichen Gründen – stattdessen verschrieb er sich dem sozialen Engagement, beteiligte sich schon als Jugendlicher an verschiedenen antifaschistischen Initiativen und gründete während der „Revolution auf Granit“ 1990, der ersten großen Demonstration auf dem Maidan, ein gewaltfreies Streikkomitee an seiner Schule. Später studierte er Philosophie und angewandte Anthropologie in Kyjiw und Sussex.
Butkevych arbeitete als Journalist unter anderem für den BBC World Service und war Co-Initiator des unabhängigen ukrainischen Radiosenders Hromadske Radio. Er gründete auch das Menschenrechtszentrum ZMINA sowie das No Borders Project mit, das Geflüchteten in der Ukraine hilft und sich seit Beginn des Krieges in den Gebieten Donezk und Luhansk auch den Binnenvertriebenen im Land widmet. Butkevych wurde zu einer vielbeachteten Figur der ukrainischen Zivilgesellschaft. Nach Beginn der Großinvasion meldete er sich freiwillig zur Armee und geriet in russische Kriegsgefangenschaft.
Freilassung durch Gefangenenaustausch
Am 18. Oktober 2024 kam Butkevych nach über zwei Jahren Kriegsgefangenschaft frei. Zusammen mit 94 anderen ukrainischen Soldaten war er gegen 95 russische ausgetauscht worden. Drei Tage zuvor, als seine Freilassung noch nicht absehbar war, erschien im Anthea Verlag eine Sammlung mit seinen Texten aus den Jahren 2004 bis 2022 und mit Solidaritätsbekundungen seiner Freunde. Steffen Beilich, Irina Bondas, Camilla Elle, Jonas Empe, Carlotta Freigang und André Hansen übersetzten die Texte ins Deutsche. Sie sind um Schwarz-Weiß-Fotos von Butkevych, ein Glossar und QR-Codes ergänzt, mit denen die Originale einsehbar sind.
Die Einleitung zum Band stammt von der Menschenrechtlerin Oleksandra Matviichuk vom Center for Civil Liberties, die 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Als sie den Preis im Dezember desselben Jahres entgegennahm, erwähnte sie in ihrer Dankesrede auch ihren Freund Maksym Butkevych: „Er und andere ukrainische Kriegsgefangene sowie alle inhaftierten Zivilisten müssen freigelassen werden.“ Butkevych war am Ende nicht einfach nur Kriegsgefangener: der „Oberste Gerichtshof“ im von Russland besetzten Luhansk verurteilte ihn im März 2023 in einem Scheinprozess zu 13 Jahren Lagerhaft. Demnach soll er kurz vor seiner Gefangennahme in der Stadt Sjewjerodonezk (Region Luhansk) mit einem Granatwerfer auf Zivilisten geschossen haben – was allein deshalb unmöglich ist, weil Butkevych zum damaligen Zeitpunkt noch in Kyjiw stationiert war.
Das beim Anthea Verlag erschienene Buch enthält auch Texte zum Gerichtsprozess, darunter einen Artikel der staatsnahen russischen Tageszeitung Kommersant über Butkevychs Verurteilung und dessen Rede beim Berufungsverfahren. Darin gibt er an, unter Androhung psychischer und physischer Gewalt, von der er einen Vorgeschmack erhalten habe, ein falsches Geständnis unterschrieben zu haben. Amnesty International und andere Menschenrechtsorganisationen prangerten den Scheinprozess und forderten seine Freilassung.
Ein Friedensaktivist an der Front
Das Paradox, das im Zentrum des Buchs steht, ist bereits im Titel angelegt: Wie konnte sich der Linke, Christ und Friedensaktivist Butkevych, der zu Beginn der Nullerjahre gegen den Irakkrieg protestierte, dazu entschließen, selbst zur Waffe zu greifen? Darauf finden sich im Buch ausführliche Antworten. In einem Interview Anfang April 2022 etwa sagte Butkevych, er sei Antimilitarist, seit er denken könne und finde, militärische Strukturen müssten einen klar umgrenzten Zuständigkeitsbereich haben. „Zurzeit fühle ich mich aber am richtigen Platz.“ Er werde nicht ewig in der Armee bleiben, sondern so lange, „wie das, was für uns in der Ukraine am wertvollsten ist, geschützt werden muss“. Im letzten Text vor seiner Gefangennahme, „Ostern mit Kalaschnikow“, der von Mitte April bis Anfang Mai 2022 entstand, beschreibt Butkevych seine Gefühle an der Front wie folgt:
„An Ostern wird der Sieg des Lebens über den Tod gefeiert und dieses Jahr begehe ich dieses Fest als freiwilliges Mitglied einer Struktur, die Menschen geschaffen haben, um zu töten und getötet zu werden. Beim Nachtdienst spreche ich die Ostergebete für den Sieg über den Tod. Direkt neben mir steht die Maschine, die mit dem Ziel entworfen wurde, Tod oder Verletzungen zuzufügen. Und weißt du was? Ich erkenne zwar das Paradoxe an der Situation, aber ich fühle kein wirkliches Unbehagen dabei.“
Scheuklappenmentalität im Westen
Man kann nur hoffen, dass das Buch viele deutsche Leser und Leserinnen findet. Denn es ist nicht nur eine Chronologie von Butkevychs Arbeit und seiner Zeit in der Armee sowie in Gefangenschaft, sondern es erläutert auf zutiefst menschliche und aufrichtige Weise die Lage der Menschen in der Ukraine. Butkevych geht in seinem Ostertext auch auf die nicht nachlassenden Forderungen westlicher Intellektueller ein, man solle der Ukraine keine weiteren Waffen liefern und schnellstens einen Kompromiss mit Russland eingehen. Diese zeugten von Scheuklappenmentalität und Realitätsverlust, urteilt er. Denn man sehe jetzt in Butscha, Irpin, Hostomel, Mariupol, Charkiw, Tschernihiw und anderswo: „russkij mir“ – übersetzt: „russische Welt“ und in zweiter Bedeutung „russischer Frieden“ – bedeute „Tod, Leid, Demütigung und Zerstörung“.
Die russische Staatsführung wolle alles, was mit der ukrainischen Gemeinschaft zu tun habe, auslöschen, schreibt Butkevych. Und weil man dieses Vorrücken des Todes nicht zulassen könne, sei es notwendig, zum einzigen Mittel in dieser Situation zu greifen: zur Waffe. Zugleich fordert er, allen Widrigkeiten zum Trotz, eine humanistische Haltung zu bewahren: „Wir dürfen nicht zulassen, dass Hass und Schmerz uns blind machen, dass wir unsere Offenheit und Vielfalt, unser Mitgefühl und unsere Freiheit opfern.“
Maksym Butkevych „Am richtigen Platz: Ein ukrainischer Friedensaktivist im Krieg“, Anthea, Berlin 2024, 114 Seiten, Preis: 15,00 Euro.
![]()
Gefördert durch:
Verwandte Themen
Newsletter bestellen
Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.