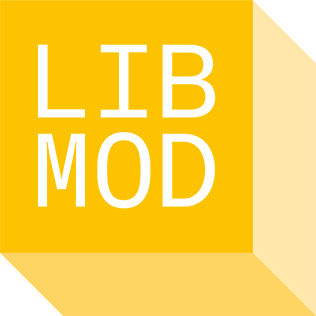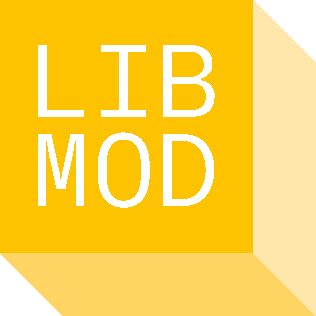Zwischen Alarm und Alltag. Wie Krankenhäuser in Sumy nahe der Front weiterarbeiten

Trotz wachsender Gefahr durch heranrückende russische Truppen harren viele Menschen im Gebiet Sumy aus, vor allem Ältere und Familien mit Kindern. Warum tun sie das? Wie halten Kliniken und Kinderkrankenhäuser den Betrieb unter Beschuss aufrecht? Und was droht, wenn die Front noch näher rückt?
Kyjiw im Sommer, ein ganz „normaler“ Morgen nach einem nächtlichen Luftangriff. Acht Tote, Dutzende Verletzte, wieder einmal. Im Hof der Hilfsorganisation People in Need steht abfahrbereit ein weißer Geländewagen. Doch niemand steigt ein. Dabei hätte die Fahrt zu mehreren Krankenhäusern im 350 Kilometer entfernten Sumy längst beginnen sollen. Aber die Sicherheitsfreigabe verzögert sich. „Wir sind in den vergangenen Monaten bei Fahrten in diese Region vorsichtiger geworden“, sagt Alyona Budagovska, die den Einsatz koordiniert. Endlich setzt sich das Auto in Bewegung – in Richtung russische Grenze.
Seit Monaten spitzt sich die Lage im Nordosten der Ukraine zu. Russische Truppen sind von Kursk aus über die Grenze vorgestoßen, stellenweise bis auf knapp zwanzig Kilometer an die Stadt Sumy heran. Es fehlt nicht mehr viel, dann kann sie auch von schwerer Artillerie und ferngesteuerten Drohnen mit geringerer Reichweite getroffen werden. Ein Szenario wie in Cherson, wo diese Drohnen systematisch auf Menschenjagd gehen, könnte drohen.
Wladimir Putin sprach zuletzt offen von der Einrichtung einer „Pufferzone“ in der Grenzregion – und schloss auch die Einnahme der Stadt Sumy nicht aus. Zwar erklärte der ukrainische Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyi Ende Juni, man habe die russische Offensive gestoppt. Doch die Bedrohung bleibt. Die Menschen in der Region – und mit ihnen NGOs, Behörden, Krankenhäuser – leben im Schwebezustand. Zwischen Alltag und Alarm, zwischen langfristiger Planung und Evakuierungsvorsorge.

„Wenn Alarm ist, beten wir einfach zu Gott“
Erster Halt auf dem Weg nach Sumy: das Regionalkrankenhaus von Konotop, rund siebzig Kilometer vor der Grenze zu Russland. Auch hier werden die Angriffe seit Monaten intensiver. Im September 2024 schlug eine Shahed-Drohne nur fünfzig Meter vor der Klinik ein, 260 Fenster und Türen wurden zerstört. „Es war ein massiver Angriff auf die ganze Stadt“, sagt Klinikdirektor Vasyl Zgonnyk. Nur weil es spätabends war, kam niemand ums Leben.
Mit 400 Betten ist das Krankenhaus in Konotop die zentrale medizinische Einrichtung der Region. Etwa 1.500 Patientinnen und Patienten werden hier pro Monat behandelt. Die Zahl sei seit 2022 stabil, sagt Zgonnyk – aber das Durchschnittsalter steige: „Die Jungen sind weg. Geblieben sind die Alten.“
Eine von ihnen ist die 76-jährige Hanna Zynevska. Seit über fünfzig Jahren lebt sie in Konotop, nun liegt sie mit Brust- und Rückenschmerzen auf der Station. „Wohin sollten wir denn gehen?“, fragt sie. Ihre Tochter lebt mit der Enkelin inzwischen in Ternopil – im etwas sichereren Westen des Landes. Aber zu ihr ziehen und alles zurücklassen? Für Zynevska ist das keine Option. Umgekehrt will die Tochter nicht mehr nach Konotop kommen – viel zu gefährlich sei das mit Kind. Zynevskas Haus hat keinen Keller. „Wenn Alarm ist, beten wir einfach nur zu Gott“, sagt sie.

Neuer Luftschutzraum: barrierefrei und gut belüftet
Damit im Krankenhaus nicht mehr gebetet werden muss als ohnehin schon, wird im Untergeschoss gebohrt und gehämmert. Zwei Bauarbeiter montieren eine Rollstuhlrampe, Kabel hängen von der Decke, an den fabrikneuen Türen klebt noch die Schutzfolie. In wenigen Wochen soll hier ein Luftschutzraum entstehen: barrierefrei, belüftet, mit medizinischer Grundausstattung.
Am Ende des Hauptgangs beginnt der alte Backsteinkeller: dunkel, feucht, mit sowjetischen Uralt-Liegen. „So sah es hier vorher überall aus“, sagt Serhii Pribyl, Ingenieur der Hilfsorganisation People in Need (PIN), der die Baustelle leitet. Um den Keller vollständig zu sanieren, fehlt das Geld.
Seit Beginn des Angriffskriegs rüstet das Krankenhaus seine kritische Infrastruktur auf. Jede Abteilung verfügt inzwischen über Notstromgeneratoren und Langzeitakkus, auf dem Dach liefern Solarpanels Energie – finanziert durch ein GIZ-Programm des Bundeswirtschaftsministeriums.
Der neue Schutzraum soll nicht nur die Kranken, sondern auch das Personal schützen. In den ersten Monaten nach dem russischen Großangriff waren viele Angestellte geflohen. Inzwischen ist das Team wieder stabil, doch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind permanent am Limit ihrer Kräfte. „Unser Hauptproblem heißt Burnout“, sagt Zgonnyk. „Aber die Leute bleiben, trotz allem.“ Zwar liegen auch Evakuierungspläne bereit, doch die Direktive ist klar: Das Krankenhaus soll weiterarbeiten, so lange wie möglich.
In Sumy ist die Front immer in Hörweite
Zweite Station: die Stadt Sumy. Dort ist die Front längst in Hörweite. Kaum angekommen, grollen erste Einschläge russischer Artillerie und Gleitbomben in der Ferne. Trotzdem sind vereinzelt Menschen in der Innenstadt unterwegs. Ein Fahrradfahrer rollt über die zentrale Soborna-Straße, Kinder schaukeln vor der Kathedrale, der Imbiss BRLN verkauft weiter „deutsche und ukrainische Schawarma“. Zwischen leeren Schaufenstern und ausgeräumten Verkaufsflächen sind noch einige wenige Cafés und Geschäfte geöffnet. Das Stadttheater wiederum hat die Sommersaison gerade abgebrochen. Sie hätte ohnehin im Keller stattgefunden.
Und ein paar Bars gibt es noch, in die es die Jugend abends zieht. „Aber die lassen sich an einer Hand abzählen“, sagt ein Gast, der an der Soborna33 am Tresen sitzt. Draußen sitzen ein Dutzend Gäste, trotz Luftalarm, direkt gegenüber der Statue des Nationaldichters Taras Schewtschenko. Zwei aktuelle Artikel des Stadtmagazins Tsukr bringen die Stimmung auf den Punkt: „Elf neue Lokale in Sumy“ und „Wie sich die Menschen in Sumy auf gewaltfreien Widerstand vorbereiten können.“

„Wir bereiten uns auf alle Szenarien vor“
„Die Zukunft bleibt unvorhersehbar. Wir bereiten uns auf alle Szenarien vor“, sagt auch Dmytro Troyiuk. Der 37-Jährige koordiniert die humanitäre Arbeit von PIN in Sumy und stimmt sich dabei eng mit der Stadtverwaltung und anderen Hilfsorganisationen ab.
Aktuell geht es vor allem um Reparaturen, psychologische Resilienz und Hilfe für Vertriebene aus den Grenzdörfern. Viele brauchen finanzielle Soforthilfe und dringend ein Dach über dem Kopf. Doch der Wohnungsmarkt ist überlastet – auch, weil sich Sumy seit der ukrainischen Offensive im russischen Gebiet Kursk im Sommer 2024 zusehends in eine Garnisonsstadt verwandelt hat.
Trotz der Bedrohung durch die näher gerückten russischen Truppen herrsche bei vielen Menschen in der Stadt weiter eine gewisse Zuversicht, beobachtet Troyiuk. „Wer jetzt noch hier ist, hat sich an die Lage gewöhnt. Nicht weil es leichter wird, sondern weil sich die Dinge nicht schlagartig verschlechtern, sondern langsam. Von Tag zu Tag, Schritt für Schritt. Und so verlässt man sein Zuhause nicht einfach.“

Russischer Doppelschlag tötet 35 Menschen, darunter mehrere Kinder
Dabei haben die Bewohnerinnen und Bewohner in den vergangenen Monaten mehrere brutale Raketenangriffe durchlebt. Am Palmsonntag traf ein russischer Doppelschlag erst das Kongresszentrum, dann einen Trolleybus an einer belebten Kreuzung. 35 Menschen starben, mehr als 120 wurden verletzt. Es war Mittagszeit, der Bus war voll bis auf den letzten Platz.
Die Spuren des Einschlags sind immer noch sichtbar. Ein Gebäude an der Kreuzung ist bis heute komplett aufgerissen. Ringsherum: beschädigte Universitätsgebäude und historische Bauten, deren Fenster mit Sperrholz vernagelt sind. In der angrenzenden Fußgängerzone liegen Plüschtiere zwischen frischen Blumen. Auf dem Shirt eines Teddybären steht: „Remember me”.
Drei der bei dem Angriff verletzten Kinder wurden ins Kinderkrankenhaus St. Zinaida in Sumy eingeliefert. „Einer der Jungen ist hier gestorben“, sagt die stellvertretende Direktorin Yuliia Pedenko. Wenn die Stadt unter Beschuss stehe, sei die Belastung für das Personal besonders hoch – vor allem, wenn verletzte Kinder eingeliefert würden. Für die Kleinen sei es traumatisierend, Verwundete in ihrem Alter zu sehen. Deshalb kümmern sich im St.-Zinaida-Krankenhaus fünf Psychologinnen rund um die Uhr nicht nur um die Kinder, sondern auch um ihre Eltern und das Personal.

„Ich weiß nicht, wo man sich heute überhaupt noch sicher fühlen kann“
In einem Therapieraum sitzt die 27-jährige Olena mit ihrem Sohn Lev. Der Dreijährige hat Sprachprobleme, zwischen Bauklötzen und Stofftieren übt er mit einer Therapeutin. Ob sie sich im Krankenhaus sicher fühle? Olena zögert. „Ich weiß nicht, wo man sich heute überhaupt noch sicher fühlen kann.“
Als der große Krieg begann, war Lev sechs Monate alt. Sumy war fast vollständig von russischen Truppen umzingelt. Olena floh mit ihm nach Bamberg, kehrte aber ein Jahr später zurück. „Es ist besser, bei meiner Familie zu sein, als weit weg und sie kaum zu sehen.“ Ihr Mann ist Berufssoldat, er ist meist im Einsatz an der Front. Für den dreijährigen Lev gehört das Grollen von Artillerie längst zum Alltag. Wenn es in der Ferne kracht, sagt er manchmal: „Alles in Ordnung, das sind unsere Jungs.“
„Wer bleibt, tut das selten freiwillig“
„Psychische Belastungen gab es natürlich auch schon früher“, sagt Svitlana Budko. Die Psychologin und Kinderärztin betreut Lev und Olena. „Aber der Krieg hat eine zusätzliche Schicht darüber gelegt.“ Angststörungen, Panikattacken und Schlaflosigkeit gehören mittlerweile zum Alltag – genau wie posttraumatische Belastungsstörungen. Auslöser seien nicht nur direkte Einschläge, sondern auch das Heulen der Sirenen, das Surren der Drohnen, die ständige latente Bedrohung.
Budko erzählt von einem Mädchen, das mit Freunden auf einem Spielplatz war, als eine Rakete einschlug. Sie überlebte schwer verletzt, ihr Großvater starb. Die Mutter brach zusammen. „In solchen Fällen begleiten wir die ganze Familie“, sagt die Psychologin. „Wenn eine Mutter keine inneren Ressourcen mehr hat, kann sie sich kaum um ihr Kind kümmern.“
Der Krieg macht vor allem Kinder krank
Budko rät den Menschen mit Kindern grundsätzlich dazu, die Region zu verlassen. Die langfristigen Folgen eines Lebens in permanentem Kriegszustand seien für Kinder oft gravierender als die Angst im unmittelbaren Moment der Gefahr. Und doch bleiben viele Familien in der Region. Warum? „Wer bleibt, tut das selten freiwillig“, sagt Budko. „Diejenigen, die über die nötigen Mittel verfügten, sind längst fort. Wer noch hier ist, hat oft keine andere Wahl.“
Vor allem in den Dörfern nahe der ukrainisch-russischen Grenze sind viele Menschen an Haus und Hof gebunden. Budko berichtet von einer Großfamilie mit sechs Kühen. Die Eltern verließen den Hof selbst dann nicht, als ihr Sohn bei einem Angriff verletzt wurde. Wie hätten sie ihr Vieh zurücklassen können, die einzige Möglichkeit für die Familie, ein wenig Geld zu verdienen? Die Mutter plagen seither starke Schuldgefühle.
Doch in den vergangenen Monaten siedeln immer mehr Familien aus der Grenzregion zumindest nach Sumy um. „Raus aus den Dörfern, rein in die Stadt – das ist oft der erste Schritt.“, sagt Svitlana Budko. Eigentlich, findet sie, müssten die Menschen noch weiter weg ziehen: dorthin, wo es wirklich sicher ist.

Von der Intensivstation direkt in den Luftschutzraum
Erst am 6. März schlug eine Shahed-Drohne direkt gegenüber der Kinderklinik in Sumy ein, detonierte aber nicht. Vor dem Krieg behandelte das Haus rund 11.000 Kinder im Jahr. Heute sind es 6.000 bis 7.000. 98 Ärzte und 170 Pflegekräfte sind in der Stadt geblieben und halten den Betrieb aufrecht – auch im provisorischen Luftschutzraum im Keller.
Dort liegen drei Teenager auf Matratzen, scrollen durch TikTok und Instagram. Dabei ist gerade gar kein Alarm. Sie dürfen den Luftschutzraum trotzdem noch nicht verlassen. „Wenn wir zum Beispiel mit einer Injektion begonnen haben, bleiben sie hier unten, bis sie abgeschlossen ist“, erklärt die stellvertretende Direktorin der Klinik, Yuliia Pedenko.
Bei jedem Alarm müssen alle Kinder und Jugendlichen in den Keller – auch nachts. Manche werden direkt von der Intensivstation dorthin gebracht, zum Beispiel, wenn das Personal mit einem Angriff rechnet und eine Therapie beginnen will, die nicht unterbrochen werden darf.
„Es motiviert uns, dass wir das für die Kinder tun“
Der provisorische Schutzkeller bietet Liegeplätze für etwa 50 Kinder, minimalistisch, ohne Spezial-Ausstattung. Deshalb entsteht nun unter der Erde ein moderner Schutzraum: mehrere Hundert Quadratmeter groß, ausgestattet mit getrennten Bereichen für chirurgische, neurologische und infektiöse Patienten. „Wir wollen, dass die Kinder hier gemeinsam mit ihren Eltern übernachten können“, sagt Pedenko.
PIN-Ingenieur Serhii Pribyl prüft währenddessen die Statik und Maße im Rohbau. In drei Monaten soll alles fertig sein. Was andernorts Jahre dauern würde, muss hier so schnell wie möglich gehen. „Es motiviert uns, dass wir das für die Kinder tun“, sagt er.
Auch die Direktorin des Krankenhauses, Viktoria Buhaenko, kann es kaum erwarten. Sie ist stolz auf ihre Einrichtung – eines der modernsten Kinderkrankenhäuser der Ukraine, mit über einhundertjähriger Geschichte.
Buhaenko war auch in der Zeit unmittelbar nach dem russischen Großangriff in der Stadt geblieben. Wochenlang hatte sie mit ihrer Belegschaft im Krankenhaus gelebt und rund um die Uhr weitergearbeitet. „Wenn der neue Schutzraum steht, werden wir das Gefühl haben, das Maximum getan zu haben“, sagt Buhaenko. Dann lächelt sie kurz und fügt hinzu: „Noch sicherer wäre es wohl nur mit einer eigenen Flugabwehr.“ Als wir uns verabschieden, heulen wieder die Sirenen.
![]()
Verwandte Themen
Newsletter bestellen
Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.