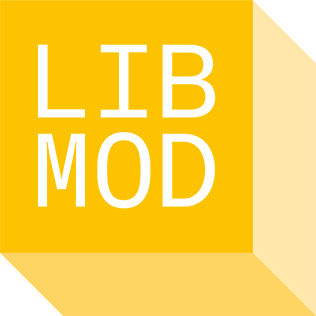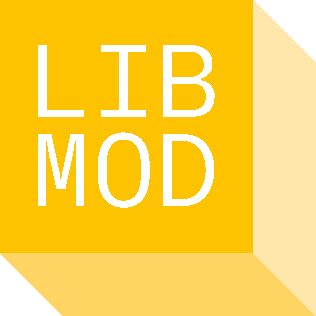Können Wahlen in der Ukraine den russisch-ukrainischen Krieg beenden?

Russlands Forderung nach Wahlen in der Ukraine ist kein demokratisches Anliegen, sondern Teil einer gezielten Destabilisierung des Landes. Andreas Umland analysiert die Ursprünge, Funktionen und Gefahren dieses Propagandanarrativs im Kontext der russischen Invasion.
Am 30. März 2025 veröffentlichte The Economist einen Artikel mit dem Titel „Die Aussicht auf vorgezogene Wahlen in der Ukraine versetzt alle in Aufruhr“ („The prospect of early elections in Ukraine has everyone in a spin“). Darin wird spekuliert, dass die respektlose Behandlung von Wolodymyr Selenskyj durch das Weiße Haus und der darauf folgende Anstieg der Unterstützung für Selenskyj in ukrainischen Meinungsumfragen den ukrainischen Präsidenten dazu veranlassen könnten, sich für baldige Wahlen 2025 zu entscheiden. Selenskyj könnte damit, so die Argumentation, die jüngste verstärkte internationale – vor allem US-amerikanische – Infragestellung der Legitimität seiner Herrschaft nach Ablauf seiner regulären Amtszeit 2024 neutralisieren. Bis zum jüngsten Popularitätszuwachs Selenskyjs war ein wichtiges Motiv der Forderung nach Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Ukraine die Vorstellung, dass ein daraus resultierender Wechsel im ukrainischen Präsidentenamt und Regierungsapparat die russisch-ukrainischen Friedensverhandlungen erleichtern würde.
Die Entstehung einer seltsamen Erzählung
Schon vor dem Wahlsieg Donald J. Trumps im November 2024 war die These, dass ein Wechsel der nationalen Führung in der Ukraine eine Voraussetzung für die Beendigung des Krieges Russlands sei, Gegenstand öffentlicher Debatten geworden. Vor zwei Jahren begannen verschiedene vom Kreml kontrollierte oder ihm nahestehende Medien, die Idee zu verbreiten, dass die Legislative und Exekutive der Ukraine 2023–2024 neu gewählt werden müssten, da sie sonst ihre politische Legitimität verlieren würden. Seit 2023 haben einflussreiche westliche Kommentatoren, vom ehemaligen Fox-News-Moderator Tucker Carlson bis zum Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE), Tiny Kox, diese russische Argumentationslinie in unterschiedlichem Maße übernommen.
Heute lautet die Kernaussage der öffentlichen Kommunikation des Kremls, dass eine Ablösung von Selenskyj seit dem 21. Mai 2024 notwendig sei, da er angeblich seine Legitimität verloren habe. Ein anderer Staatschef würde laut Moskaus hetzerischer Rhetorik die Ukraine weniger „faschistisch“ machen und Russland damit zu Kompromissen bewegen. Die neue US-Regierung hat Moskaus Beschreibungen von Selenskyj zwar nicht wörtlich wiederholt, doch scheint Russlands Abneigung gegen ihn mit der aktuellen Stimmung im Weißen Haus zu korrelieren. Selenskyj wurde während Trumps erster Amtszeit als US-Präsident 2017–2021 zu einem Problem, als Trump wegen eines Telefonats mit dem damals gerade neu gewählten ukrainischen Präsidenten den Versuch eines Amtsenthebungsverfahren durchlaufen musste.
Seit Trump im Januar 2025 zum zweiten Mal US-Präsident wurde, hat er versucht, sein Wahlversprechen einzulösen, den russisch-ukrainischen Krieg schnell zu beenden. Der vorgeschlagene, bedingungslose Waffenstillstand wurde jedoch nur von Kyjiw akzeptiert, während Moskau erklärte, einer Waffenruhe nur unter bestimmten Bedingungen zuzustimmen. Dazu gehörten russische Forderungen nach Einschränkungen der nationalen Souveränität, militärischen Verteidigungsfähigkeit und territorialen Integrität der Ukraine. Es ist nicht einmal klar, inwieweit die Vorschläge des Kremls zur Einschränkung der Unabhängigkeit, Größe und Stabilität des ukrainischen Staates ein echtes Verhandlungsangebot oder reines Theater waren.
Dennoch übt Washington Druck auf Kyjiw aus, weitere Zugeständnisse zu machen, denen Selenskyj bisher mit breiter gesellschaftlicher Unterstützung widerstanden hat. Damit dürfte er neuerlich für Unbehagen im Weißen Haus sorgen. Infolgedessen findet die russische Idee, dass ein Führungswechsel in Kyjiw notwendig sei, um den Krieg zu beenden, weiterhin Anhänger in der Trump-Administration.
Wahlen, Krieg und der Rechtsstaat
Nach ukrainischer Rechtslage hätten ohne die Großinvasion Russlands in der Ukraine reguläre Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Oktober 2023 bzw. März 2024 stattfinden müssen. Das ukrainische Gesetz „Über die Rechtsordnung während des Kriegszustands“ aus dem Jahr 2000, das 2015 erneuert wurde, verbietet jedoch die Durchführung von Präsidentschafts‑, Parlaments- oder Kommunalwahlen während des Ausnahmezustands. Zur Verschiebung der Parlamentswahlen heißt es in Artikel 83 der ukrainischen Verfassung: „Endet die Amtszeit der Werchowna Rada der Ukraine während der Geltung des Kriegsrechts oder Ausnahmezustands, wird ihre Amtszeit bis zum Tag der ersten Sitzung der Werchowna Rada der Ukraine verlängert, die nach Aufhebung des Kriegsrechts oder Ausnahmezustands gewählt wird.“
Dementsprechend wurden die nationalen Wahlen 2023–2024 bis nach Ende der Kampfhandlungen und Aufhebung des 2022 verhängten Kriegsrechts verschoben. Eine solche Aussetzung normaler demokratischer Prozesse während groß angelegter Kriegshandlungen war in der Geschichte etlicher Demokratien gängige Praxis, darunter unter anderem im Vereinigten Königreich während des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Sie ist heute in den Rechtsvorschriften verschiedener Länder weltweit verankert, wie beispielsweise in Artikel 115 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland.
Darüber hinaus können unmittelbar nach dem Ende des von Russland versuchten Vernichtungskrieges keine sinnvollen Wahlen stattfinden. Nach geltenden Vorschriften müssen Parlamentswahlen 60 Tage und Präsidentschaftswahlen 90 Tage nach Aufhebung des Ausnahmezustandes stattfinden. Angesichts der schwerwiegenden Auswirkungen des Krieges auf die ukrainische Gesellschaft im Allgemeinen und ihre Wahlinfrastruktur im Besonderen würde ein schlüssiger, legitimer und demokratischer Wahlkampf und entsprechendes Wahlprozedere jedoch eine angemessene Vorbereitung unter friedlichen Bedingungen erfordern.
Ein Bericht der renommierten ukrainischen Wahlbeobachtungsgruppe Opora (Basis) vom Januar 2025 kommt zu dem Schluss, dass nationale Wahlen frühestens sechs Monate nach Beendigung des Ausnahmezustands möglich wären. Tatsächlich könnten sie sogar erst ca. ein Jahr nach Beendigung der Kämpfe stattfinden. Bereits 2023 waren die Fraktionschefs der Werchowna Rada zu dem Schluss gekommen, dass ein neues Wahlgesetz verabschiedet werden müsse, um allen folgenreichen Veränderungen Rechnung zu tragen, die die Ukraine seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 erlebt hat und bis zu dessen Ende noch erleben könnte.
Jüngste Forderungen nach einer raschen politischen Erneuerung an der Spitze der Ukraine sind daher bestenfalls verfrüht und naiv, schlimmstenfalls manipulativ und subversiv. Die groß angelegte Invasion Russlands mit anhaltenden schweren Kämpfen im Osten und Luftangriffen im ganzen Land hat die Abhaltung ordnungsgemäßer Wahlen unmöglich gemacht, solange der Krieg andauert. In einer öffentlichen Erklärung ukrainischer Nichtregierungsorganisationen, die von Opora organisiert wurde, heißt es am 20. Februar 2025: „Die instabile Sicherheitslage, die Gefahr von Beschuss, Terroranschlägen und Sabotage sowie die großflächige Verminung von Gebieten stellen erhebliche Hindernisse in allen Phasen des Wahlprozesses dar.“
Die Aggression Russlands seit 2022 hat Millionen ukrainischer Bürger innerhalb und außerhalb der Ukraine zu Flüchtlingen gemacht. Die neue demografische Situation würde neue Formen der Stimmabgabe, eine Aktualisierung des ukrainischen Wählerverzeichnisses und die Einrichtung einer großen Anzahl von Wahlbezirken im Ausland erfordern. Innerhalb der Ukraine haben die Bombardierung ukrainischer Siedlungen durch Russland und deren Nachwirkungen Teile der ukrainischen Wahlinfrastruktur zerstört, darunter auch Gebäude, etwa Schulen, die als Wahllokale genutzt wurden. Dennoch ist es dem Kreml in den letzten zwei Jahren gelungen, einen angeblichen Mangel an demokratischer Repräsentativität in der ukrainischen Führung zu einem zentralen Thema in internationalen Diskussionen über Wege zur Beendigung des russisch-ukrainischen Krieges zu machen.
Russlands manipulative Forderungen nach Wahlen
Seit 2023 fordern russische und pro-russische Politiker und Influencer, dass die Ukraine unter Bedingungen eines umfassenden Krieges nationale Wahlen durchführt. Mit der Beharrlichkeit und Verbreitung dieses Vorschlags wiederholt Moskau eine Strategie, die es 2014 nach seiner verdeckten Intervention im Donbas auf dem ukrainischen Festland begonnen hatte. Von 2014 bis 2021 nutzten Moskau und seine Verbündeten die von Kyjiw unter Zwang unterzeichneten Minsker Vereinbarungen, um von der Ukraine die Durchführung regionaler und lokaler Wahlen in den sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk zu fordern.
Diese Forderung wurde gestellt, obwohl die ukrainische Regierung keine Kontrolle über die Gebiete hatte, in denen demokratische Wahlkampagnen und Stimmabgaben hätten organisiert werden sollen. Stattdessen übte die russische Regierung die Herrschaft über die beiden De-facto-Regime in den ukrainischen Oblasten Luhansk und Donezk aus. Bis zu ihrer Annexion im Jahr 2022 hat Moskau zu keinem Zeitpunkt Bereitschaft signalisiert, seine Kontrolle über die beiden Pseudorepubliken, die es im Frühjahr 2014 künstlich in der Ostukraine geschaffen hatte, zu verringern. Dennoch bestand der Kreml darauf, dass Kyjiw Wahlen in diesen Gebieten abhält, bevor es Zugang zu ihnen erhält.
Weder in den Jahren 2014–2021 noch seit 2023 waren Moskaus Forderungen nach mehr Demokratie in der Ukraine von russischer Sorge um Volksherrschaft und Legitimität in der Ukraine getrieben. Der Kreml unterdrückt innerhalb Russlands Oppositionsparteien, Rechtsstaatlichkeit, politischen Pluralismus, zivilgesellschaftliches Engagement und Meinungsfreiheit – teilweise unter Einsatz tödlicher Gewalt. Diese und andere Umstände deuten darauf hin, dass andere Motive hinter dem außenpolitischen Verhalten Moskaus im Allgemeinen und seiner Forderung nach Wahlen in der Ukraine im Besonderen stehen.
Nach den Worten von Maria Popova und Oxana Shevel ist das letztendliche Ziel der russischen Führung die Destabilisierung und „Vassalisierung“ der Ukraine. Je nach der konkreten Situation setzt Russland verschiedene Kombinationen kinetischer und nicht-kinetischer Kriegsführung ein, um sein Ziel der Unterwanderung des ukrainischen Staates zu erreichen. Der Kreml hofft, dass ein – anders als in Russland – vollständig kompetitiver Wahlkampf und offene landesweite Wahlen in der Ukraine neue Möglichkeiten für Moskaus hybride Kriegsführung bieten. In einer Übergangsphase für den ukrainischen Staat und das politische System würde Moskau versuchen, die ukrainische Gesellschaft zu polarisieren, innerukrainische Konflikte zu verschärfen und ausländische Beobachter zu verwirren.
Moskaus Forderung nach Wahlen unter unmöglichen Bedingungen ist eines von mehreren Instrumenten im nichtmilitärischen Instrumentenkasten des Kremls, zu denen Cyberkrieg, Desinformationskampagnen, wirtschaftlicher Druck, Verhandlungstheater, terroristische Anschläge und die Korruption von Politikern gehören. Ukrainische NGOs warnen in dem oben genannten gemeinsamen Appell, dass „die größte Herausforderung für die Wahldemokratie in der Ukraine die Einmischung Russlands in diesen Prozess sein wird, das dazu bereit sein wird, alle Mittel einzusetzen – von Cyberangriffen bis zur direkten Bestechung von Wählern, von der Verbreitung von Desinformation und Spaltung der Gesellschaft mit deren Hilfe bis zur Diskreditierung von Kandidaten, die für die russischen Behörden ‚inakzeptabel‘ sind, und der Finanzierung von Kampagnen loyaler Politiker“.
Ende März 2025 unternahm der russische Präsident einen weiteren Versuch, einen Führungswechsel in Kyjiw herbeizuführen, indem er vorschlug, die ukrainische Regierung durch eine vorübergehende UN-Verwaltung zu ersetzen. Diese solle nach Putins Worten „demokratische Wahlen abhalten, eine funktionsfähige Regierung ins Amt bringen, die das Vertrauen des Volkes genießt, und dann Verhandlungen mit ihnen über einen Friedensvertrag aufnehmen“. Putin fügte hinzu: „Unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen, mit den Vereinigten Staaten, sogar mit europäischen Ländern und natürlich mit unseren Partnern und Freunden könnten wir die Möglichkeit der Einführung einer vorübergehenden Regierung in der Ukraine diskutieren“. Der Vorschlag Moskaus war jedoch so seltsam, dass sogar Washington ihn sofort ablehnte.
Wie weiter?
Unbedarfte Beobachter des postsowjetischen Raums, darunter westliche Politiker und ihre Berater, werden von der Propagandamaschine des Kremls über die Ursachen und möglichen Lösungen der russisch-ukrainischen Konfrontation in die Irre geführt. Hinter der Forderung nach nationalen Wahlen in der Ukraine steht nicht Sorge um demokratische Legitimität in der Ukraine, sondern das Ziel des Kremls, das Land zu destabilisieren. Im Idealfall würde ein hastig vorbereiteter und unzureichend gesicherter Wahlkampf und Wahlprozess unter schwierigen Bedingungen Moskau zahlreiche Einfallstore für Einmischung bieten. Der Kreml würde sich für antiwestliche Kandidaten einsetzen, politische Spannungen verschärfen, Misstrauen unter Wählern und ausländischen Beobachtern säen sowie die Wahlinfrastruktur infiltrieren.
Die oben zitierte „Roadmap für die Organisation von Nachkriegswahlen in der Ukraine“ von Opora und ähnliche Studien enthalten relevante politische, rechtliche und technische Empfehlungen für die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung eines Wahlkampfs und einer gesamtnationalen Abstimmung nach Aufhebung des Kriegsrechts. Die folgenden zusätzlichen Empfehlungen gelten für die öffentliche Kommunikation staatlicher und nichtstaatlicher Akteure, die an der Souveränität, Demokratie und Stabilität der Ukraine interessiert sind:
- Erinnern Sie Ihre Zielgruppen an die Vorkriegsgesetzgebung der Ukraine, die landesweite Wahlen unter Bedingungen eines bewaffneten Konflikts und des Kriegsrechts verbietet.
- Heben Sie die relevanten Artikel in den Verfassungen und Gesetzen anderer demokratischer Länder hervor, die die Durchführung von Wahlen während eines Ausnahmezustands aussetzen.
- Heben Sie den russischen Ursprung und die subversiven Absichten der Forderung nach nationalen Wahlen in der Ukraine während oder kurz nach der Vollinvasion Russlands hervor.
- Stellen Sie Moskaus Kritik an ukrainischer Demokratie und Rechtsstaatlichkeit den Realitäten der Pseudodemokratie und Justizwillkür in Russland gegenüber.
- Beschreiben Sie demokratischen Errungenschaften der Ukraine seit ihrer Unabhängigkeit im Jahr 1991, wie beispielsweise häufige Führungswechsel.
- Stellen Sie Moskaus Narrativ zu den Wahlen in der Ukraine in den größeren Zusammenhang russischer politischer Kriegsführung gegen die Ukraine.
Dieser Artikel basiert auf einem aktuellen Bericht des SCEEUS.
![]()
Verwandte Themen
Newsletter bestellen
Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.