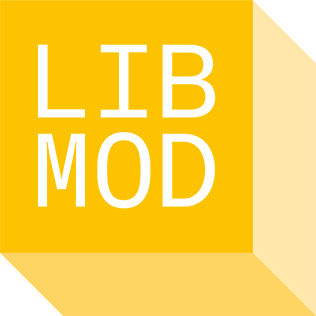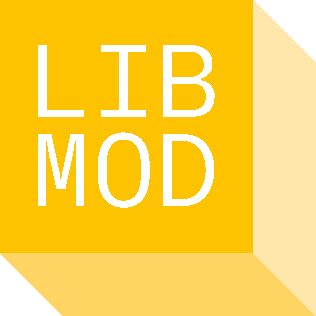Europas Sicherheit neu denken. Warum die Ukraine ein Partner sein muss – nicht bloß ein Schlachtfeld

Da der Einfluss Russlands wächst und die Einheit der NATO ungewiss erscheint, müssen die europäischen Länder eine gemeinsame Strategie entwickeln und die Ukraine als wichtigen Sicherheitspartner anerkennen.
Jetzt, da der Krieg in der Ukraine ins vierte Jahr geht, offenbart ein Rückblick eine unbequeme Wahrheit. Vor zwei Jahren sahen Beobachter Russlands strategische Niederlage angesichts der Tapferkeit und des Einfallsreichtums der Ukraine voraus. In diesem Jahr haben sich die Debatten der Experten auf die zunehmende Einmischung Russlands in Europa verlagert, einschließlich seiner Attentatsversuche, seiner Infrastruktursabotage in der Ostsee und seiner Einmischung in die rumänischen Wahlen. Nach der Rede des US-Vizepräsidenten JD Vance in München äußerten einige Experten und Politiker Zweifel an der Stärke der transatlantischen Beziehungen. Europa muss seine Sicherheitspolitik überdenken, das ist inzwischen klar.
Rote Linien ziehen
Viele gemütliche Jahrzehnte unter dem Sicherheitsschirm der USA scheinen Europas Bewertung der Bedrohungslage verzerrt zu haben. Wenn es um die Sicherheit des Kontinents geht, haben die europäischen Staats- und Regierungschefs das Thema immer wieder als „Lastenverteilung“ bezeichnet. Diese Formulierung scheint unangemessen, denn Sicherheit ist keine Last. Sie ist eine Notwendigkeit, die allem anderen vorausgeht, einschließlich Demokratie und Wohlstand. Sie ist nicht kostenlos, aber sie ist viel billiger als ein dauerhafter Mangel an Sicherheit.
Ein weiterer Punkt, der Anlass zur Sorge gibt, ist die Haltung Europas gegenüber Russland. Die Diskussionen auf dem Sicherheitsforum 2025 in Vilnius zeigen, dass die Idee, eine rote Linie zu ziehen und mit Gewalt zu reagieren, wenn Russland sie überschreitet, zumindest von den Rednern des Forums, allesamt Insider der europäischen Politik, wohl immer noch als umstritten angesehen wird. Dieses Zaudern hat zu der Situation beigetragen, in der sich Europa heute befindet. Ein Panel in Vilnius, das sich mit der Frage beschäftigte, welche strategischen Herausforderungen Europa für Russland schaffen könnte, konzentrierte sich auf die reine Abschreckung. Aus meiner Sicht hätte man zumindest über Informationsoperationen innerhalb Russlands sprechen sollen.
Die Frage nach der Rolle der USA und der NATO in der europäischen Sicherheit bleibt zentral. Es scheint klar zu sein, dass sich die USA von ihrer traditionellen Rolle im Bündnis und auf dem europäischen Kontinent wegbewegen. Der Trend ist nicht neu, er begann mit Präsident Obamas „Schwenk nach Asien“ und setzte sich fort mit Präsident Trumps Forderungen nach einer Erhöhung der europäischen Verteidigungsausgaben und seiner Entscheidung im Jahr 2020, die US-Truppen aus Deutschland abzuziehen. Unter Präsident Biden mit seinem „America is back!“-Ansatz schien er sich umzukehren, doch unter Trump 2.0 ist der amerikanische Isolationismus wieder mit voller Wucht zurück. Der Trend, dass die USA ihre Verteidigungsanstrengungen zunehmend auf den pazifischen Raum ausrichten, hält nun schon seit mehr als einem Jahrzehnt an und wird sich vermutlich auch nach der Trump-Regierung nicht umkehren. Europa braucht eine neue Vision von seiner Sicherheit mit weniger US- und mehr ukrainischer Beteiligung.
Die größte Armee des Kontinents
Die Ukraine hat bereits einen Beitrag zur europäischen Sicherheit geleistet, indem sie der russischen Invasion drei Jahre lang Widerstand geleistet hat. Die Ukraine ist groß, sie ist resilient, und sie ist nicht in drei Tagen gefallen, wie die meisten westlichen Beobachter vorhergesagt hatten. Dennoch hat es den Anschein, dass Europa die Ukraine immer noch als etwas Auswärtiges betrachtet, das nichts mit seiner gemeinsamen Sache zu tun hat. Die europäischen Länder konzentrieren sich in erster Linie auf ihre eigenen Abschreckungsbemühungen innerhalb der NATO, während die Ukraine gerade einmal genügend Unterstützung erhält, um weiterzukämpfen.
Die Ukraine stellt heute die größte Armee des Kontinents. Das wird wahrscheinlich auch nach dem Ende des Konflikts so bleiben. Ebenso hat sie eine Vision, wie sie zur europäischen Sicherheit beitragen könnte. Präsident Selenskyj schlug beides vor: die Stationierung ukrainischer Truppen in Europa nach dem Ende des Krieges, um einige US-Streitkräfte zu ersetzen, und die Ukraine als Kern, um den die europäischen Länder eine gemeinsame Armee bilden könnten. Selenskyj sagte auch, dass die Ukraine anderen Ländern beibringen könne, wie man einen modernen Landkrieg führt, da sie das einzige Land in Europa ist, das diesbezüglich über frische Erfahrungen verfügt.
Die Ukraine als Partner, nicht als Hilfsempfänger
Die ukrainische Rüstungsindustrie ist hochinnovativ und entwickelt sich schnell, sie ist auch offen für eine Zusammenarbeit mit westlichen Partnern. Die ukrainische Industrie bevorzugt das sogenannte „dänische Modell“, bei dem Geberländer in der Ukraine produzierte Waffen zur Verwendung durch die ukrainische Armee kaufen. Dieses Modell könnte sich jedoch als nicht tragfähig erweisen, da die europäischen Wähler sich dagegen sträuben könnten, Waffen von außerhalb der EU zu kaufen, ohne dass dadurch Arbeitsplätze im eigenen Land geschaffen werden. Sowohl die Ukraine als auch Europa müssen die in der EU-Strategie für die Verteidigungsindustrie vorgesehene Zusammenarbeit intensivieren. Die Ukraine muss ihre Exportpolitik für überschüssige Waffen, die ihre Armee nicht selbst benötigt, optimieren und klar kommunizieren. Die europäischen Regierungen könnten Joint Ventures mit ukrainischen Unternehmen finanzieren, die einen Teil ihrer Produktion in die Ukraine verlagern würden.
Die Ukraine sollte schrittweise in die von Deutschland im Jahr 2022 initiierte European Sky Shield Initiative (ESSI) integriert werden. Angesichts der unglücklichen Nähe der Ukraine zu Russland würde die Einbeziehung der Ukraine in die europäischen Luftverteidigungspläne die Wahrscheinlichkeit verringern, dass russische Raketen Europa erreichen. Es stimmt, dass eine realistische Diskussion über einen Sky Shield für die Ukraine gerade erst begonnen hat, aber es ist höchste Zeit, darüber zu diskutieren, ob eine Integration der Ukraine in den europäischen Luftverteidigungsrahmen prinzipiell möglich wäre. In dieser Diskussion muss die Ukraine als Partner auftreten, nicht als abhängiges Gebilde oder als reiner Hilfsempfänger.
Bedarf nach Führung
Der Widerstand der Ukraine gegen die russische Aggression hat gezeigt, wie Einigkeit und rasches Handeln den Angriff selbst eines militärisch stärkeren Gegners abwehren können. Als eine auf Konsens basierende Organisation ist die NATO für eine solche Führungsrolle leider nicht gut geeignet. Die gegenwärtige Krise erfordert eine proaktive Politik. Großbritannien und Frankreich haben bereits damit begonnen, eine Koalition der Willigen zu bilden, um ein mögliches Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine zu erreichen. Sie müssen jedoch bereit sein, auch ohne Russlands Zustimmung einzugreifen, da der Krieg auf dem Hoheitsgebiet der Ukraine stattfindet. Die Koalition sollte genügend Mitglieder anziehen, um Russland dauerhaft abzuschrecken, und sich auf ein klares Mandat einigen, um das russische Militär im Falle einer erneuten Aggression entgegenzutreten.
Außerdem ist zu bedenken: Selbst wenn die Verhandlungen mit Russland irgendwann vorankommen sollten, muss Europa weiter an seiner Widerstandsfähigkeit arbeiten. Auf eine friedliche Lösung zu hoffen ist zwecklos, wenn Russland ein autoritärer Staat bleibt. Solche Regime neigen dazu, innere Spannungen durch Aggression nach außen zu lösen. Europa muss erkennen, dass es nicht einfach an der alten Normalität festhalten kann. Angesichts der veränderten strategischen Ausrichtung der USA ist es für Europa an der Zeit, mit dem Zaudern aufzuhören.
Redaktion: Yelizaveta Landenberger
![]()
Verwandte Themen
Newsletter bestellen
Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.