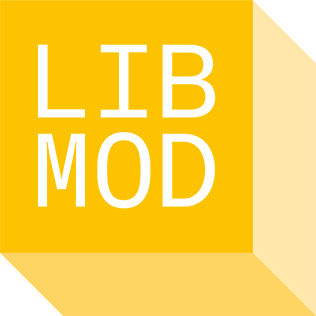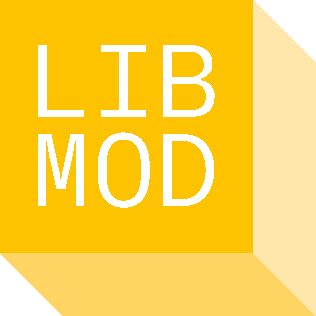Der Angriff auf die Antikorruptionsbehörden gefährdet die EU-Beitrittsperspektive der Ukraine

Ein umstrittenes neues Gesetz, das unabhängige Antikorruptionsbehörden der Kontrolle der Generalstaatsanwaltschaft unterstellen soll, stößt auf entschlossenen Widerstand aus der ukrainischen Zivilgesellschaft. Das Gesetz bringt nicht nur die Gewaltenteilung in Gefahr, sondern auch den EU-Beitritt des Landes.
Die ukrainische Regierung riskiert ausgerechnet in einem kritischen Moment des EU-Beitrittsprozesses eine Aushöhlung rechtsstaatlicher Prinzipien. Durch das am 22. Juli von der Werchowna Rada, dem ukrainischen Parlament verabschiedete Gesetz Nr. 12414, das Präsident Wolodymyr Selenskyj noch am selben Abend mit seiner Unterschrift in Kraft setzte, werden zentrale Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit verletzt. Laut EU-Kommission zählen ein unabhängiges Justizsystem, der Kampf gegen Korruption und die Achtung der Grundrechte – sowohl in der Gesetzgebung als auch in der Praxis – zu den tragenden Säulen der europäischen Wertegemeinschaft. Das Gesetz wirft die Frage auf, ob hinter ihm ein bewusstes machtpolitisches Kalkül der politischen Führung in Kyjiw steht.
Das Gesetz stellt politische Loyalität über Rechtsstaatlichkeit
Das Gesetz Nr. 12414 sieht vor, die beiden bisher unabhängig agierenden Behörden SAP (Sonderstaatsanwaltschaft) und NABU (Nationales Antikorruptionsbüro) der Generalstaatsanwaltschaft zu unterstellen – ein Schritt, der die seit 2015 aufgebaute Antikorruptionsarchitektur de facto zerstören würde.
Damit verlieren beide Schlüsselbehörden ihre Unabhängigkeit und werden künftig durch die Generalstaatsanwaltschaft kontrolliert – eine Institution, die trotz formaler Zugehörigkeit zur Justiz in der Praxis anfällig für politische Einflussnahme ist. Es handelt sich um keinen Reformschritt, sondern einen Rückfall in die Zeit vor den Maidan Protesten, als politische Loyalität systematisch über Rechtsstaatlichkeit gestellt wurde.
Diese Entwicklung ist symptomatisch für den grundlegenden Konflikt zwischen Machterhalt und Reformen, der die ukrainische Politik prägt. Doch im Krieg, da sicherheitspolitische Prioritäten gelten und der innen- wie außenpolitischen Druck minimiert ist, wird dieser Zielkonflikt zum existenziellen Stresstest für die ukrainische Demokratie.
Historisch galten NABU und SAP als Leuchtturmprojekte, die mit internationaler Unterstützung systemische Korruption in der Ukraine eindämmen konnten. Ihre Erfolge bei der Verfolgung hochrangiger Fälle machten sie zugleich angreifbar, insbesondere dort, wo ihre Arbeit mit bestehenden Interessen in Konflikt geriet. Das Gesetz Nr. 12414 markiert einen Tiefpunkt im jahrelangen Ringen um institutionelle Unabhängigkeit.
Eine ernsthafte Gefährdung für die EU-Beitrittsperspektive
Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und Korruptionsbekämpfung sind keine bloßen Erwartungen, sondern eine notwendige Bedingung für einen EU-Beitritt. Diese Grundprinzipien sind in Artikel 2 des Vertrags über die EU verbindlich festgeschrieben und bilden die rechtliche Basis des Beitrittsprozesses. Konkretisiert wird dieser im EU-Acquis, besonders in den Kapiteln 23 („Justiz und Grundrechte“) und 24 („Justiz, Freiheit und Sicherheit“). Zentral sind richterliche Unabhängigkeit, der Aufbau wirksamer Antikorruptionsbehörden sowie der Schutz individueller Grundrechte in Gesetzgebung und Praxis.
Vom Gesetz Nr. 12414 betroffen ist insbesondere Cluster 1 der aktuellen Beitrittsverhandlungen, also jener Abschnitt, der die grundlegenden rechtsstaatlichen und institutionellen Voraussetzungen für eine EU-Mitgliedschaft definiert. Die Reform eröffnet nicht allein Ungarn neue Hebel zur Blockade. Vielmehr könnten alle EU‑Mitgliedstaaten, in denen die Unterstützung für die ukrainische EU‑Mitgliedschaft fragil ist, künftig ähnliche Veto‑Strategien verfolgen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat bereits mehrfach gezeigt, wie ein Einzelstaat mit seinem Vetorecht Hilfspakete und Verhandlungsphasen blockieren kann. Selbst bei wohlwollender Bewertung durch die EU‑Kommission könnten Rückschritte in der Reform‑ und Rechtsstaatlichkeit für solche Staaten als Vorwände dienen.
Zugleich betonen EU‑Spitzenvertreter wie Ursula von der Leyen unmissverständlich: Jede Aushöhlung der Institutionen und Korruptionsbekämpfung kann die Beitrittsperspektive ernsthaft gefährden.
Die Lage wird durch die derzeitige Koppelung des Screening-Prozesses der Ukraine mit der Republik Moldau zusätzlich erschwert. Es besteht die reale Gefahr einer Zwei-Klassen-Dynamik innerhalb der EU-Erweiterungspolitik. Rückschritte in der Ukraine könnten zu einer politisch sichtbaren Auseinanderentwicklung führen, mit potenziell weitreichenden Konsequenzen für beide Länder. Auch wenn geopolitische Erwägungen derzeit für eine kontinuierliche Unterstützung der Ukraine sprechen, bleibt der Beitrittsprozess rechtlich eng gefasst und an klare Bedingungen gebunden. So könnten sich kurzfristige innenpolitische Machtinteressen in der Ukraine zu einem erheblichen Hindernis für die europäische Perspektive des Landes entwickeln.
Massiver Widerstand aus der ukrainischen Zivilgesellschaft
Ohne unabhängige Korruptionsermittlungen droht die Einschränkung wichtiger EU-Finanzierung wie der Ukraine-Facility. Mit einem Volumen von knapp 50 Milliarden Euro bis 2027 ist dieses Programm eine zentrale Säule der öffentlichen Ausgaben der Ukraine. Die Auszahlung der Mittel ist an klare Bedingungen geknüpft – insbesondere an eine glaubwürdige Kontrolle durch ukrainische Ermittlungsbehörden. Wird deren Unabhängigkeit infrage gestellt, steht mehr als nur die Fortführung der finanziellen Unterstützung auf dem Spiel. Es ist ein potenzieller Vertrauensbruch mit erheblichem Eskalationsrisiko.
Das Gesetz Nr. 12414 könnte weitreichende Signalwirkung entfalten: Er würde nicht nur das aktuelle Unterstützungsniveau gefährden, sondern auch Zweifel an der Verlässlichkeit und Reformfähigkeit der Ukraine im EU-Beitrittsprozess schüren. Diese Szenarien sind zwar noch hypothetisch, die ukrainische Regierung kann aber nicht einfach so tun, als ob sie nicht existieren.
Während Militärhilfen grundsätzlich nicht an Bedingungen geknüpft werden dürfen, sieht das bei zivilen Finanzhilfen ganz anders aus. Hier stellen sich zunehmend Fragen zur langfristigen Tragfähigkeit des westlichen „Reform-für-Geld“-Modells. Ob und wie die ukrainische Regierung oder ihre westlichen Partner diese Debatte angesichts der aktuellen Umstände führen können, ist unklar.
Das Gesetz Nr. 12414 stieß in der ukrainischen Zivilgesellschaft auf massiven Widerstand. Sie reagierte mit lautstarken öffentlichen Protesten in vielen Städten des Landes, und das trotz der anhaltenden russischen Luftangriffe. Das macht deutlich, dass es der Zivilgesellschaft nicht um einen Regierungswechsel geht, sondern um die Verteidigung demokratischer Standards – auch und gerade im Krieg.
Ein neuer Gesetzentwurf soll die Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden wiederherstellen
Inmitten des andauernden Kriegs steht die ukrainische Regierung vor schwierigen Aufgaben: Wie lassen sich Sicherheit, europäische Integration und demokratischer Anspruch in Einklang bringen?
Zwar ist der demokratische Rückschritt teilweise durch das Kriegsrecht erklärbar, doch das verabschiedete Gesetz Nr. 12414 droht, diese Ausnahmesituation zu verfestigen. Die Schwächung unabhängiger Anti-Korruptionsbehörden lässt Zweifel daran aufkommen, ob Parlament und Regierung hier tatsächlich einer Kriegsnotwendigkeit folgen oder andere politischen Interessen verfolgt werden.
Erst nach anhaltendem öffentlichem Druck und internationaler Kritik lenkte Präsident Selenskyj ein. Er brachte am 24. Juli einen neuen Gesetzentwurf in die Werchowna Rada ein, der die Unabhängigkeit von NABU und SAP wiederherstellen soll. Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk kündigte daraufhin an, dass der Entwurf in einer Sondersitzung am 31. Juli behandelt werden soll, denn das Parlament befindet sich derzeit in der Sommerpause. Konkrete Details zum neuen Entwurf liegen bislang nicht öffentlich vor.
Der neue Entwurf ist ein wichtiges Signal, doch ohne die formelle Rücknahme von Gesetz Nr. 12414 bleiben Zweifel bestehen, nicht zuletzt wegen unterbrochener Korruptionsermittlungen und des entstandenen Vertrauensverlusts. Die ukrainische Zivilgesellschaft warnt zu Recht vor Gefahren für die Unabhängigkeit ukrainischer Institutionen und – im größeren Zusammenhang – für die Gewaltenteilung. Die ukrainische Zivilgesellschaft behauptet ihre Schlüsselrolle in der Verteidigung demokratischer Standards, selbst unter Kriegsbedingungen. Dabei sieht sie sich als Verteidigerin der europäischen Grundwerte und entschiedene Unterstützerin des EU-Beitrittsprozesses der Ukraine.
![]()
Verwandte Themen
Newsletter bestellen
Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.