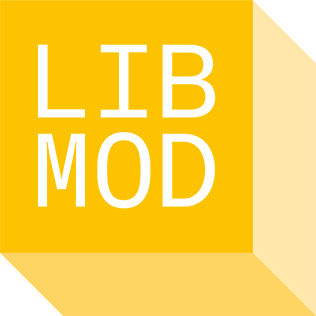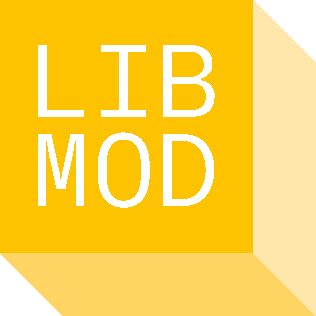Das Risiko des Nichthandelns

Europa braucht eine gemeinsame Verteidigungsstrategie mit der Ukraine – und sollte das Land als strategischen Partner begreifen. Eindrücke und Einschätzungen von einer LibMod-Reise mit Bundestagsmitarbeiter:innen von CDU/CSU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen nach Kyjiw.
Am 6. September stand ich spätabends vor dem Kyjiwer Hauptbahnhof und wartete auf den Zug nach Chelm, jenem polnischen Grenzbahnhof, über den der 25 Stunden lange Weg aus Kyjiw nach Berlin führt. Wie in fast jeder Nacht gab es Luftalarm, seit mehreren Stunden schon. Das Bahnhofsgebäude war gesperrt, Polizisten schickten Passagiere in den Luftschutzkeller unter dem Bahnhof. Aus allen Richtungen näherten sich Kyjiw die tödlichen Shahed-Drohnen, jede von ihnen dreieinhalb Meter lang, mit zweieinhalb Metern Spannweite und einer Sprengladung zwischen 50 und 90 Kilogramm.
Acht Stunden später wachte ich im Zug auf und hörte, wie Passagierinnen in meinem Wagen mit ihren Angehörigen telefonierten: „Bist du am Leben?“, „Alles gut bei euch?“. In jener Nacht griff Russland mehrere Städte in der Ukraine mit einer Rekordzahl von über 800 Drohnen an, dazu kamen Marschflugkörper und ballistische Raketen. Unter den Toten in Kyjiw waren ein Neugeborener und seine Mutter. Das Gebäude des Ministerkabinetts im Regierungsviertel stand in Flammen.
Kein Waffenstillstand in Sicht
Aus Sicht ukrainischer Expert:innen, mit denen eine Delegation von LibMod und Bundestagsmitarbeiter:innen in den Tagen vor diesem Angriff in der Ukraine sprach, nutzt Putin die Illusion von Diplomatie momentan vor allem, um Zeit zu gewinnen, Waffen anzuhäufen und sowohl Angriffe auf ukrainische Städte zu intensivieren als auch den Druck an der Front zu erhöhen. Nichts spräche für eine Bereitschaft Russlands zum Dialog oder zu echten Friedensverhandlungen.
Im Gegenteil: Momentan habe Putin nicht den geringsten Anreiz, den Krieg zu beenden. Die russischen Streitkräfte geben an allen Frontabschnitten den Takt vor. „Russlands imperialistische Vorstellung und seine Pläne gegenüber der Ukraine haben sich nicht geändert“, sagt Yehor Cherniev, Abgeordneter im Verteidigungsausschuss der Werchowna Rada, dem ukrainischen Parlament. Ernsthafte Verhandlungen mit Russland oder gar ein schneller Friedenschluss seien deshalb eine Illusion.
In der westlichen Debatte geht es beim wichtigen Thema Sicherheitsgarantien stets nur um die Zeit nach einem Waffenstillstand. Ein solcher ist aber in absehbarer Zukunft kaum vorstellbar. Kommandeure der Territorialverteidigung äußerten gegenüber LibMod die Einschätzung, dass die Kämpfe in den nächsten sechs bis zwölf Monaten intensiver werden.
Kann die Ukraine sich weiterhin verteidigen?
Die Ukraine verfügt zurzeit nicht über die notwendigen Kapazitäten für eine effiziente Verteidigung. Die ukrainischen Streitkräfte können zwar die Frontlinie stabilisieren, aber für eine Gegenoffensive fehlen die Reserven. In den kommenden Monaten wird daher wahrscheinlich weder der russischen noch der ukrainischen Seite ein Durchbruch gelingen.
In dieser Lage setzt die Ukraine auf eine Strategie, die der ehemalige Verteidigungsminister Andriy Zagorodnyuk als „strategische Neutralisierung“ beschreibt: Die Ukraine versucht, mit Hilfe ihrer Partner, Russland am Boden und in der Luft zu blockieren. Das Schwarze Meer bietet dafür ein eindrucksvolles Beispiel: Kyjiw hat die Seeblockade seiner Schwarzmeerhäfen durch Russland nicht auf diplomatischem Wege gelöst, sondern durch entschlossenes, unkonventionelles Handeln. Durch regelmäßige Seedrohnenangriffe auf russische Kriegsschiffe im Schwarzen Meer Schiffe in Sewastopol verdrängte die Ukraine die russische Flotte Richtung Osten. Russische Kriegsschiffe müssen heute so vorsichtig sein, dass sie kaum noch Schaden anrichten können, und in der ukrainischen Hafenstadt Odesa legen wieder fast genauso viele Handelsschiffe an wie vor dem Krieg.
Auf ähnliche Weise geht die Ukraine gegen die Hauptfinanzierungsquelle der russischen Wirtschaft vor: die Ölindustrie. Sie greift gezielt Ölinfrastruktur an und stört damit die russische Logistik, schwächt Moskaus Einnahmen durch Ölexporte und schafft Versorgungsengpässe an russischen Zapfsäulen. So kann Russland den Krieg zwar fortsetzen, seine Kriegsziele aber nicht erreichen.
Was die ukrainischen Streitkräfte jetzt dringend brauchen, sind Luftverteidigungssysteme, Munition und Ersatzteile – unter anderem für die Gepard-Systeme, die sich als besonders wirksam gegen die immer häufiger eingesetzten Shahed-Drohnen erwiesen haben. An der Front benötigt die Armee außerdem Artilleriegeschosse und unbemannte Bodenfahrzeuge. Letztere können das Minenlegen und die Bergung von Verwundeten übernehmen – was die Moral der ausgedünnten ukrainischen Truppen stärken würde.
Langstreckenwaffen für die Ukraine
Um die militärischen Fähigkeiten Russlands effektiv zu stören, ist entscheidend, dass die ukrainische Armee Ziele – etwa Militärflughäfen oder Munitionsfabriken – tief im Landesinneren angreifen kann. Darin besteht mittelfristig auch die effizienteste Methode der Luftabwehr. Solche Angriffe kann die Ukraine selbst ohne westliche Langstreckenraketen erfolgreich durchführen, wie etwa die Operation Spinnennetz im Sommer 2025 zeigte, als ukrainische Drohnen viele russische Kampfflugzeuge zerstörte oder beschädigte.
Um die russische Angriffsfähigkeit zu lähmen, reichen Angriffe mit Drohnen allerdings nicht aus. Deutschland und andere europäischen Partner sollten der Ukraine nicht nur die Erlaubnis erteilen, militärische und strategische Ziele tief im russischen Hinterland anzugreifen, sondern die Ukraine auch mit den nötigen Langstreckenwaffen ausrüsten. Reichweite und Feuerkraft der ukrainischen Tiefenschläge ließen sich dadurch dramatisch verbessern.
„Seid bereit für den Krieg der Zukunft“
Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass Verteidigung ohne ständige technische Weiterentwicklung kaum möglich ist. Die ukrainische Luftverteidigung stört Lenkbomben per Elektronik und gegen Shahed-Drohnen setzt sie seit Kurzem erfolgreich Abfangdrohnen ein. Gegen ballistische Raketen – weiterhin eine große Gefahr für die gesamte Ukraine – schützen die US-amerikanischen Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot am effektivsten. Da sie aber knapp und teuer sind und nur von den USA – einem zunehmend unzuverlässigen Partner –hergestellt werden, versucht Kyjiw eine heimische Alternative zu entwickeln.
Um Russland aufzuhalten, muss Europa dabei effizienter mit der Ukraine zusammenarbeiten. Statt von europäischer Unterstützung für die Ukraine zu sprechen, sollte Europa sich als einen Partner begreifen, der mit der Ukraine zusammen eine gemeinsame Verteidigungsstrategie entwickelt. Dieses Umdenken muss in Deutschland noch stattfinden, in den nordischen und baltischen Ländern ist dies längst geschehen.
Europa findet nach jahrzehntelanger sicherheitspolitischer Abhängigkeit von den USA nur langsam in die Rolle, selbst für seine Sicherheit zu sorgen. Dabei kann die europäische Sicherheitspolitik von Erfahrung der Ukraine lernen. Die ukrainische Abgeordnete Inna Sovsun rief die Delegation des Bundestages auf: „Seid bereit für die Kriege der Zukunft – und seid innovativ.“
Militärische Innovationen in der Ukraine fördern
Das bedeutet auch, dass es zum jetzigen Zeitpunkt wenig sinnvoll ist, nennenswerte Drohnenarsenale in Deutschland anzulegen – denn diese wären bis zu ihrem Einsatz längst von der rasanten technologischen Entwicklung überholt. Stattdessen müssen hierzulande Produktionskapazitäten für die Zukunft ausgebaut werden – Kapazitäten, die schon heute der Verteidigung der Ukraine dienen könnten. Bis es soweit ist, muss sich allerdings noch einiges ändern. So sind bürokratische Prozesse in Deutschland viel zu langsam. Jedes Softwareupdate in einem Waffensystem braucht momentan bis zu eineinhalb Jahre, bevor es zugelassen ist.
Die Ukraine hingegen baut enorm schnell und innovativ Produktionskapazitäten aus. Der limitierende Faktor ist die nicht ausreichende Finanzierung. Gleichzeitig entscheidet die Geschwindigkeit der Innovationen darüber, ob die Ukraine Russland Einhalt gebieten kann. „Momentan hat Russland mehr Ressourcen und skaliert und implementiert ukrainische Innovationen schneller als die Ukraine selbst“, sagt Yehor Cherniev. Auch andere Gesprächspartner:innen aus Militär und ukrainischen Think Tanks teilen diese Einschätzung. Und genau dort, wo das nötige Geld für die Massenproduktion fehlt, könnten europäische Partner einspringen – im Interesse ihrer eigenen Sicherheit.
Vor Ort in der Ukraine lernen
Auch bei der militärischen Ausbildung könnte die Ukraine Erfahrungen weitergeben. Dazu müssten vermehrt Soldat:innen und Fachleute in die Ukraine reisen, um vor Ort zu lernen wie in einem von Drohnen dominierten Schlachtfeld Aufklärung, Angriff, Kommunikation, taktische Medizin und Luftabwehr funktionieren. Einige europäische Länder sind in dieser Hinsicht bereits aktiv, darunter Dänemark. Deutschland jedoch scheut weiterhin das Risiko, das mit solchen Reisen verbunden ist. In diesem Fall aber ist das Risiko des Nichthandelns größer: Schließlich ist die Bedrohung durch Drohnen die größte Lücke in der deutschen Verteidigung. Nach den jüngsten russischen Drohnenangriffen auf Polen und mehreren Luftraumverletzungen durch russische Drohnen in Rumänien wäre eine Ausbildung direkt in der Ukraine besonders sinnvoll.
Waffenstillstand, aber unter welchen Bedingungen
Die Ukrainer:innen sehen in einem Waffenstillstand ohne klare Sicherheitsgarantien vor allem die Gefahr, dass Russland seine Aggressionen unvermindert fortsetzt. Trotz zunehmender Kriegsmüdigkeit, trotz täglicher – und vor allem nächtlicher – Angriffe durch Drohnen und Raketen und dreieinhalb Jahre andauerndem Schlafmangel zeigt die ukrainische Gesellschaft nach wie vor keine Bereitschaft, einem Waffenstillstand um jeden Preis zuzustimmen.
Sämtliche Gesprächspartner:innen in Kyjiw betonten, es gehe Putin nicht um Territorien, sondern darum, die Ukraine als souveränen Staat zu vernichten – eine Meinung, die auch viele westliche Wissenschaftler:innen und Expert:innen teilen. Die russische Armee, so ihre Einschätzung, würde an den Grenzen der Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, die Russland teilweise besetzt und wie die Krim völkerrechtswidrig für sich beansprucht, nicht Halt machen. Im Gegenteil: Sie würde eine Waffenruhe nutzen, um für einen weiteren Angriff aufzurüsten.
Die ukrainische Bevölkerung knüpft ihre Zustimmung zu einem Waffenstillstand deshalb klar an internationale Sicherheitsgarantien. Laut der jüngsten Umfragen der ukrainischen Rating Group sind 75 % der Bevölkerung der Meinung, die Ukraine sollte einem Waffenstillstand nur unter diesen Bedingungen zustimmen. Zu den wichtigsten Sicherheitsgarantien zählen dabei die Finanzierung der Armee und die Lieferung von Waffen durch Partnerländer (52 %), die Verpflichtung von Verbündeten, im Falle eines erneuten Angriffs in den Krieg einzugreifen (48 %) sowie die internationale Überwachung des Luft- und Seeraums (44 %).
Zum Überleben reicht die jetzige Unterstützung nicht aus
Da eine mögliche Waffenruhe bisher nicht zur Debatte steht und die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine derzeit unerreichbar scheint, ist die ukrainische Armee im Moment die einzige belastbare Sicherheitsgarantie für die Ukraine. Doch während Russland seine gesamte Kriegsmaschinerie einsetzt und dabei von China, dem Iran und Nordkorea unterstützt wird, liefere Deutschland, so ein hochrangiger europäischer Diplomat gegenüber LibMod, als einer der größten Unterstützer der Ukraine bei Weitem nicht genug, um den Bedarf der ukrainischen Armee zu decken und dem Land eine effiziente Verteidigung zu ermöglichen – von der Befreiung der besetzten Gebiete ganz zu schweigen.
Um künftig erfolgreich verhandeln zu können, muss die Ukraine anders als bisher aus einer Position militärischer Stärke heraus agieren. Um sie darin zu unterstützen, müssen ihre europäischen Partner deutlich an Tempo und Entschlossenheit zulegen. Russland nutzt jede Verzögerung aus: Es ist nur eine Frage weniger Wochen, bis an Kyjiws Nachthimmel nicht mehr 800, sondern 1.000 Drohnen fliegen.
![]()
Verwandte Themen
Newsletter bestellen
Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.