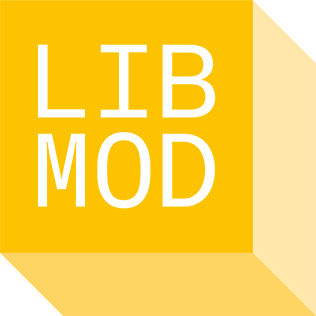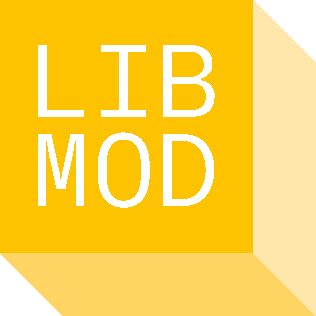Wie die Ukraine zur Lösung globaler Probleme beiträgt

Der russisch-ukrainische Krieg ist nur ein destruktiver Trend in der internationalen Staatenordnung. Doch wird sein Ausgang mitbestimmen, in welche Richtung sich die Welt entwickelt.
Populäre Begriffe wie „Ukraine-Krise” oder „Ukraine-Krieg” verleiten viele Menschen zu der Annahme, der russisch-ukrainische Krieg sei ein lediglich regionales Problem Mittelosteuropas. Dieser Fehleinschätzung zufolge hätte eine gegenüber Russland unterwürfigere ukrainische Führung nicht nur den Krieg vermeiden können. Kyjiw könnte angeblich noch immer mit Zugeständnissen an Moskau einen drohenden Flächenbrand und ein Übergreifen des „Krieges in der Ukraine” auf weitere Teile Osteuropas sowie darüber hinaus verhindern.
Aus historischer und vergleichender Perspektive betrachtet, stellt sich der russisch-ukrainische Krieg anders dar. Er ist nur eine von mehreren Ausflüssen des heutigen Moskauer Neoimperialismus und lediglich ein Ausdruck allgemeinerer regressiver Entwicklungen rund um die Welt seit Ende des 20. Jahrhunderts. Russlands Angriff auf die Ukraine ist eine Wiederholung, Ausprägung und Vorwegnahme von Pathologien, die nicht nur Mittelosteuropa, sondern auch andere Weltregionen plagen. Die sogenannte „Ukraine-Krise“ ist weder ein Einzelfall noch ein lokales Problem. Sie ist weniger ein Auslöser als ein Symptom größerer geopolitischer und völkerrechtlicher Zersetzungstendenzen der letzten Jahre.
Gleichzeitig ist der russisch-ukrainische Krieg ein Kampf um die Zukunft Europas. Es geht bei der ukrainischen Selbstverteidigung um die Aufrechterhaltung des Prinzips der Unverschiebbarkeit von Staatsgrenzen und Unzulässigkeit solcher derzeit von Russland praktizierter Völkermordaktionen, wie die Verbringung unbegleiteter Kinder einer ethnischen Gruppe in eine andere. Der Krieg berührt die Integrität der gesamten nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen UN-Staatenordnung, da er das Existenzrecht der Ukraine als integrales Mitglied der Vereinten Nationen in Frage stellt. Der russisch-ukrainische Krieg hat damit nicht nur eine europäische, sondern globale Bedeutung.
Russlands Krieg ist nur eine Ausdrucksform größerer internationalen Unordnung, die auch in Asien, Afrika und Amerika zu beobachten ist. Der Verlauf und Ausgang des russisch-ukrainischen Krieges wird jedoch in besonderem Maße den derzeit allgemeinen weltweiten Regelverfall entweder beschleunigen oder aber bremsen. Ein auch nur teilweiser Erfolg Moskaus in der Ukraine würde das Völkerrecht sowie die internationale Ordnung dauerhaft destabilisieren und könnte bewaffnete Konflikte sowie Wettrüsten in anderen Regionen auslösen.
Eine erfolgreiche Verteidigung der Ukraine hätte hingegen in dreierlei Hinsicht positive Auswirkungen auf internationale Sicherheit, globale Demokratie und weltweite Entwicklung. Ein Sieg der Ukraine würde erstens zu einer Stabilisierung der regelbasierten UN-Ordnung führen, die nach 1945 entstanden ist und sich mit der Selbstzerstörung des Sowjetblocks nach 1989 gefestigt hat. Zweitens würde sie eine Wiederbelebung von Demokratisierungstendenzen rund um die Welt begünstigen, die seit Beginn des 21. Jahrhunderts ins Stocken geraten ist und einen neuen Impuls benötigt. Und drittens können ukrainische Erfahrungen in puncto Landesverteidigung und Staatsreform zu globaler Innovation in verschiedenen Bereichen beitragen – von Cybersicherheit und Drohnenanwendung bis hin zur Reform öffentlicher Verwaltung von Transformationsstaaten.
Ein ukrainischer Erfolg würde die Staatenordnung stabilisieren
Der russisch-ukrainische Krieg ist nur einer von mehreren Versuchen mächtiger Staaten, nach Ende des Kalten Krieges in ihren jeweiligen Regionen ihr Herrschaftsgebiet zu erweitern. Im Zuge einer Wiederbelebung internationaler außenpolitischer Praxis vor 1945 versuchen oder planen revisionistische Regierungen, sich ungebeten in ihren Nachbarländern breit zu machen. Daraus resultierende Militäroperationen waren oder sind eher offensiv, repressiv und unprovoziert als defensiv, humanitär und präventiv. Mehrere revanchistische Autokratien haben oder sind versucht, das Völkerrecht durch das Prinzip der Macht des Stärkeren zu ersetzen.
Ein frühes Beispiel aus der Zeit nach dem Kalten Krieg war die Annexion Kuwaits durch den Irak im Jahr 1990, die durch die Intervention einer internationalen Koalition 1991 rückgängig gemacht wurde. Die 1990er Jahre waren geprägt von den revanchistischen Aggressionen Serbiens gegen andere ehemalige jugoslawische Republiken, die einst von Belgrad aus regiert wurden. In dieser Zeit begann auch Russland mit der Schaffung aus Moskau kontrollierter separatistischer „Republiken“ in Moldau (d. h. Transnistrien) und Georgien (d. h. Abchasien und „Südossetien“). Gleichzeitig unterdrückte Moskau rücksichtslos die Entstehung einer unabhängigen tschetschenischen Republik auf seinem eigenen Territorium.
Die volle militärische Aufmerksamkeit des Kremls richtete sich erst kürzlich auf die Ukraine. Ende Februar 2014 okkupierte Russland die südukrainische Halbinsel Krim und annektierte sie sodann. Im Frühjahr 2014 startete Moskau mit teils irregulären, teils regulären Truppen einen Pseudobürgerkrieg in der Ostukraine und schuf so genannte „Volksrepubliken“ in den ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk. Acht Jahre später gliederte Russland die ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson nach dem Muster der Krimannexion illegal in sein Staatsgebiet ein.
Die Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf die offiziellen Grenzrevisionen Russlands blieb, anders als bei früheren derartigen Versuchen des Iraks und Serbiens, halbherzig. Die relativ zaghaften Antworten des Westens seit 2014 haben das russische Abenteurertum nur weiter befeuert. Moskau fordert inzwischen von Kyjiw die freiwillige Abtretung aller Teile der vier ukrainischen Festlandregionen, die Russland 2022 annektiert hat. Dies umfasst auch einige Teile ukrainischen Staatsterritoriums, welche russische Truppen nie erobern konnten. Das Endziel des Kremls ist nach wie vor die Auslöschung der Ukraine als souveräner Staat und der ukrainischen Nation als einer von Russland unabhängigen Kulturgemeinschaft.
Gleichzeitig beugt Peking im Süd- und Ostchinesischen Meer etablierte Verhaltensregeln und verstärkt seine Vorbereitungen, die Republik China auf Taiwan mit Gewalt in die Volksrepublik einzugliedern. Venezuela hat Gebietsansprüche gegenüber dem benachbarten Guyana angemeldet. Der neugewählte US-Präsident Donald Trump hat – scheinbar Putins Beispiel folgend – eine amerikanische Annexion Kanadas und Grönlands vorgeschlagen. Etliche revisionistische Politiker, Diplomaten und Strategen weiterer Länder dürften vor diesem Hintergrund ähnliche Expansionspläne schmieden.
Die offizielle Eingliederung ukrainischer Gebiete in das russische Staatsgebiet durch Moskau ist eine besonders schwerwiegende internationale Normenverletzung. Die russischen Annexionen erfolgten durch ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats, obwohl dieses Organ 1945 unter anderem geschaffen wurde, um solche einst häufigen Grenzrevisionen zu verhindern. Das Verhalten des Kremls ist zudem angesichts der Rolle Russlands als offizieller Kernwaffen- und Depositarstaat des Nuklearen Nichtverbreitungsvertrags (NVV) von 1968 bedenklich.
Mit seinem Versuch, sich ukrainische Territorien einzuverleiben und die Ukraine als Nationalstaat zu zerstören, pervertiert Russland die Funktion seines Sonderstatus innerhalb der UN und des NVV. Moskau tritt die aus seiner besonderen Rolle in diesen Institutionen erwachsende hohe Verantwortung für die internationale Nachkriegsordnung mit Füßen. Der Kreml tut dies zudem ungeschminkt, ja geradezu demonstrativ in der Ukraine als einer Gründungsrepublik der UNO und einem Nichtkernwaffenstaat innerhalb des NVV. Dies untergräbt die normativen, politischen und psychologischen Grundlagen sowohl der Vereinten Nationen als auch des weltweiten nuklearen Nichtverbreitungsregimes. Russland hat seine Vorrechte als ständiges UN-Sicherheitsratsmitglied und offizieller NVV-Kernwaffenstaat in Instrumente verwandelt, um sein – ohnehin bereits riesiges – Staatsterritorium offiziell auszuweiten, ein teils völkermörderisches Umvolkungsprogramm in den besetzten ukrainischen Gebieten umzusetzen sowie eine ehemalige Kolonie des zaristischen und Sowjetimperiums auszuradieren.
Ein etwaiger Sieg der Ukraine über Russland wäre daher nicht nur ein regionaler Triumph von Völkerrecht und Gerechtigkeit, sondern ein Ereignis von größerer Bedeutung. Ein ukrainischer Erfolg könnte zu einem wichtigen Faktor bei der Festigung der UN-Nachkriegsordnung, Entwicklung regelbasierter internationaler Beziehungen sowie Abschreckung von künftigem internationalen Grenzrevisionismus werden. Umgekehrt würde eine Niederlage der Ukraine beziehungswiese ein ungerechter und Russland begünstigender Siegfrieden territorialen Irredentismus rund um die Welt befeuern und genozidale Kriegführung normalisieren. Der ukrainische Unabhängigkeitskampf ist somit sowohl Ausdruck umfassenderer Weltprobleme als auch – im Falle eines für Kyjiw erfolgreichen Ausgangs – ein Instrument zu deren Lösung.
Die Ukraine belebt internationale Demokratisierung
Der Angriff Russlands auf die Ukraine ist nicht nur eine von mehreren kürzlichen Herausforderung solcher Prinzipien wie nationale Souveränität von Staaten und Unverschiebbarkeit von Grenzen. Er ist auch Teil einer weiteren negativen globalen politischen Tendenz des frühen 21. Jahrhunderts, nämlich einer zunehmenden Konfrontation zwischen Demokratie und Autokratie sowie kürzlichen Schwächung ersterer. Die Eskalation dieses politischen Fundamentalkonflikts manifestiert sich unter anderem im konzertierten Angriff russischer, nordkoreanischer, chinesischer und iranischer Antidemokraten auf den – zumindest im osteuropäischen Kontext – relative liberalen, offenen und pluralistischen ukrainischen Staat.
Ein wichtiger innerer Faktor für Russlands Invasion der Ukraine ist, dass Putins Kriege seit 1999 als Quellen für die Popularität, Integrität und Legitimität seiner undemokratischen Herrschaft fungierten. In Analysen der russischen öffentlichen Unterstützung für Autoritarismus wird manchmal übersehen, dass die militärische Bestrafung, Unterwerfung und/oder Unterdrückung von freiheitsliebenden Völkern wie der Tschetschenen, Georgier und Ukrainer, glaubt man Meinungsumfragen, bei vielen einfachen Russen Rückhalt findet. Die Unterstützung eines Großteils der Bevölkerung Russlands für siegreiche militärische Interventionen – insbesondere auf dem Territorium des ehemaligen Zarenreichs und der Sowjetunion – ist eine wichtige politische Ressource und soziale Basis für Putins zunehmend autokratisches und repressives Regime.
Solche regressiven Tendenzen waren freilich bereits in Jelzins halbdemokratischem Russland der 1990er Jahre zu beobachten – etwa bei den offiziellen militärischen Eingriffen Moskaus in innere Konflikte der Republiken Moldau 1992 und Tschetschenien 1994. Unter Putin als Ministerpräsident von 1999–2000 sowie 2008–2012 und bis heute als Präsident hat die Brutalität der Gewaltoperationen Russlands zugenommen. Diese Radikalisierung ist nicht nur eine Folge des eskalierenden russischen Irredentismus an sich, sondern auch mit den grundlegenden Veränderungen im innenpolitischen Regime Russlands verbunden. Die zunehmende Aggressivität Moskaus im Ausland geht einher mit wachsender Repressivität im Inland nach Putins Machtübernahme im August 1999.
Die Feindseligkeit des Kremls gegenüber dem Westen und der Ukraine wuchs nicht zufällig infolge der ukrainischen antiautoritären Aufstände von 2004 und 2014. Der sprunghafte Anstieg russischer antiwestlicher und antiukrainischer Rhetorik hatte viel mit den triumphalen Siegen der liberal-demokratischen Orange und Euromaidan-Revolution in diesen Jahren zu tun. Die innenpolitische Entwicklung der Ukraine stellt nicht nur die neoimperialen Ansprüche Russlands auf die größte ehemalige Kolonie Moskaus in Frage. Das sich demokratisierende ukrainische Staatswesen ist auch ein konzeptionelles Gegenmodell zum im postsowjetischen Raum vorherrschenden autoritären Staatsmodell. Die bloße Existenz der relativ demokratischen Ukraine stellt die Legitimität der postkommunistischen Autokratien in Russland, Belarus, Aserbaidschan und Zentralasien infrage.
Der ukrainische Unabhängigkeitskampf ist daher nicht nur eine Verteidigung des Völkerrechts und der internationalen Ordnung, sondern auch ein Gefecht für die weltweite Demokratie. Der derzeitige Konflikt zwischen pro- und antidemokratischen Kräften ist global und hatte sich bereits vor, parallel und unabhängig vom russisch-ukrainischen Krieg verschärft. Gleichzeitig ist die Konfrontation zwischen der russischen Autokratie und der ukrainischen Demokratie eine besonders epische Schlacht dieser beiden politischen Ordnungsprinzipien mitten in Europa.
Wenn die Ukraine siegt, gewinnt das internationale Bündnis der Demokraten, während die Achse der Autokraten um Putin verliert. In diesem Szenario werden nicht nur andere Demokratien sicherer, selbstbewusster und dynamischer. Es ist wahrscheinlich, dass auch andere autoritäre Regime ins Wanken kommen – vor allem in Osteuropa, im Kaukasus und in Zentralasien. Diffusions‑, Spillover- oder Dominoeffekte solcher Veränderungen im postsowjetischen Raum wiederum könnten auch anderswo neue Demokratisierungsimpulse geben.
Umgekehrt würde ein russischer militärischer Triumph oder Siegfrieden in der Ukraine autokratische Regime und antidemokratische Politiker weltweit ermutigen. In einem solchen Szenario würden demokratische Herrschaftsformen und offene Gesellschaften als schwach, ineffektiv und impotent stigmatisiert werden. Der jüngste weltweite Niedergang der Demokratie würde sich nicht umkehren, sondern fortsetzen und womöglich beschleunigen. Die so genannte „Ukraine-Krise“ ist zwar nicht die Ursache für die aktuellen Probleme der Demokratie weltweit. Ihre gerechte, völkerrechtskonforme und dauerhafte Lösung würde jedoch die internationale Demokratisierung wiederbeleben.
Die Ukraine entwickelt übertragbare Innovationen
Ein dritter, bislang unterschätzter Aspekt des Beitrags Kyjiws zum globalen Fortschritt ist die wachsende Zahl neuer kognitiver, institutioneller und technologischer Entwicklungen in der Ukraine, die auch anderswo Anwendung finden können. Bereits vor der Eskalation des russisch-ukrainischen Krieges im Jahr 2022 leitete Kyjiw innenpolitische Reformen ein, die auch für die Modernisierung anderer Transformationsstaaten relevant sind. Nach dem Sieg des Euromaidan-Aufstands beziehungsweise der „Revolution der Würde“ im Februar 2014 begann die Ukraine mit einer grundlegenden Umgestaltung der Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft.
Dazu gehörte die Schaffung mehrerer spezieller Institutionen zur Bekämpfung von Korruption, darunter ein Antikorruptionsgericht und eine Antikorruptionsstaatsanwaltschaft sowie eine Korruptionspräventionsbehörde und ein Ermittlungsbüro für Bestechungsfälle. Das Novum dieser Institutionen besteht darin, dass sie sich ausschließlich der Verhinderung, Aufdeckung und Verfolgung von Veruntreuung, Erschleichung und Nepotismus widmen. Im April 2014 begann die Ukraine darüber hinaus mit einer weitreichenden Dezentralisierung ihres öffentlichen Verwaltungssystems, die zu einer umfassen Kommunalisierung beziehungsweise Munizipalisierung des Landes führte. Die Reform übertrug bedeutende Befugnisse, Finanzen und Zuständigkeiten von der regionalen und nationalen Ebene auf die lokalen Selbstverwaltungsorgane amalgamierter Großgemeinden, die damit zu wichtigen Machtzentren in der Ukraine wurden.
Die Euromaidan-Revolution führte auch zu einer Neugestaltung der Beziehungen zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen. Die frühe unabhängige Ukraine litt, wie auch andere postsowjetische Länder, unter einer Entfremdung zwischen Staatsbeamten und zivilgesellschaftlichen Aktivisten. Nach dem Sieg der „Revolution der Würde“ 2014 begann sich diese Kluft zu schließen. So ist beispielsweise das Kyjiwer so genannte „Reanimation Package of Reforms“ eine Koalition unabhängiger Thinktanks, Forschungsinstitute und Nichtregierungsorganisationen, die in den vergangenen 10 Jahren parteiunabhängig wichtige neue Reformgesetze für die Werchowna Rada (Oberster Rat), das Einkammerparlament der Ukraine, vorbereitet hat.
Ebenfalls 2014 unterzeichneten die Ukraine, Moldau und Georgien weitreichende Assoziierungsabkommen mit der EU, die in dieser Form bislang einzigartig sind. Die drei bilateralen Mammutpakte gehen weit über ältere Kooperationsverträge der Europäischen Union mit Nichtmitgliedsländern hinaus. Sie umfassen sogenannte vertiefte und umfassende Freihandelszonen zwischen der EU und den drei assoziierten postsowjetischen Staaten. Seit 2014 integrieren diese besonders großen Assoziierungsabkommen schrittweise die ukrainische, moldauische und georgische Wirtschaft in die europäische Wirtschaft.
Diese und andere regulatorische Innovationen, die mit der Ukraine zusammenhängen oder aus ihr stammen, haben breitere normative und politische Bedeutung. Sie bieten Reformvorlagen, institutionelle Modelle und historische Lehren für andere derzeitige und künftige Transformationsländer, nicht nur im postsowjetischen Raum. Die Erfahrungen der Ukraine können für verschiedene Nationen nützlich sein, die einen Wechsel von einer traditionellen zu einer liberalen Ordnung, von einer klientelistischen zu einer pluralistischen Politik, von einer geschlossenen zu einer offenen Gesellschaft, von einer Oligarchie zu einer Polyarchie, von einer zentralisierten zu einer dezentralisierten Herrschaft und von einer bloßen Zusammenarbeit zu einer tiefen Assoziierung mit der EU anstreben.
Während die postrevolutionären Entwicklungen der Ukraine vor allem für Transformationsstaaten relevant sind, dürften ihre jüngsten kriegsbezogenen Erfahrungen und Innovationen auch für etablierte Demokratien von Interesse sein – nicht zuletzt für NATO-Mitgliedsländer. Dieses Diffusionspotenzial betrifft sowohl das in der Ukraine gesammelte Wissen über hybride Bedrohungen und deren Abwehr als auch die zügige technologische und taktische Modernisierung der ukrainischen Streit- und Sicherheitskräfte, die auf dem Schlachtfeld und im Hinterland gegen russische Truppen und Agenten kämpfen. Seit 2014 ist die Ukraine – mehr als jedes andere Land der Welt – Ziel multivariater Angriffe Moskaus mit irregulären und regulären Einheiten, in den Medien und im Cyberspace, in der Innen- sowie Außenpolitik und auf ihre Infrastruktur, Wirtschaft sowie religiöse, akademische, schulische und weitere Kultureinrichtungen geworden.
Seit dem 24. Februar 2022 befindet sich die Ukraine in einem dramatischen Überlebenskampf gegen einen nominell weit überlegenen Angreifer. Die Regierung, Armee und Gesellschaft der Ukraine mussten sich schnell, flexibel und gründlich auf diese existenzielle Herausforderung einstellen. Dazu gehörte die rasche Einführung neuer Waffentypen und ‑anwendungen, wie beispielsweise einer Vielzahl verschiedener unbemannter Flug‑, Wasser- und Landfahrzeuge sowie deren zunehmender Einsatz mit Hilfe künstlicher Intelligenz.
In einer Bandbreite militärischer und dualer Technologien musste die Ukraine hochinnovativ sein, um dem umfassenden russischen Angriff standhalten zu können. In Bereichen wie etwa Stromtransport und ‑speicherung, elektronische Kommunikation, Informationsprüfung, Notfallmedizin, Minenräumung, posttraumatische Psychotherapie oder Wiedereingliederung von Veteranen hatten die ukrainische Regierung und Gesellschaft keine Wahl, als zügig und entschlossen reagieren. Zwar greift die Ukraine häufig auf ausländische Erfahrungen, Ausrüstung und Ausbildung zurück. Gleichzeitig entwickelt sie jedoch ständig eigene neuartige Ausrüstungen, Ansätze und Mechanismen, die auch anderswo von Nutzen sein können. Dieses Wissen und diese Erfahrungen der Ukraine werden insbesondere für Länder von Nutzen sein, die mit ähnlichen äußeren Herausforderungen konfrontiert sein könnten.
Die Ukraine als Problemlöser
Viele Beobachter sehen die Ukraine lediglich als Störfaktor für die Aufrechterhaltung beziehungsweise Wiederherstellung europäischer Sicherheit und internationaler Zusammenarbeit. Doch begann der allgemeine Anstieg von globalem Revanchismus und Autoritarismus bereits vor und weitgehend unabhängig von den jüngsten dramatischen Entwicklungen in der Ukraine. Auch die regionale Eskalation des Moskauer Neoimperialismus im postkommunistischen Raum im Allgemeinen und die völkermörderische Obsession von Russlands Nationalisten mit der Ukraine im Besonderen hat wenig mit der ukrainischen Projektionsfläche solcher russischen Pathologien zu tun. Die Ukraine ist – wie Moldau, Georgien und andere bedrängte Staaten – lediglich ein Opfer und nicht die Ursache wachsender internationaler Spannungen und antidemokratischer Trends.
Der russische militärische Angriff auf die Ukraine seit 2014 hat das bis dahin kaum wahrgenommene europäische Land – nolens volens – zu einem Brennpunkt globaler regressiver Tendenzen gemacht. Die Eskalation der Moskauer Attacke zu einer vollumfänglichen Invasion seit 2022 verwandelte die Ukraine zu einem Schauplatz einer Schlacht um die künftige Weltsicherheitsordnung, schicksalhaften Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autokratie sowie Quelle wichtiger Innovationen mit internationalem Diffusionspotenzial. Im Zuge der ukrainischen Transformation und Landesverteidigung der letzten Jahre gestalten Ukrainerinnen und Ukrainer ihren Staat sowie ihre Wirtschaft, Armee und Gesellschaft von Grund auf um. Die aus diesem ukrainischen Prozess entstandenen und entstehenden neuen Lösungsansätze, Reformmodelle und Schlüsseltechnologien dürften für viele Länder rund um die Welt von Interesse, ja für einige von lebenswichtiger Bedeutung sein.
![]()
Verwandte Themen
Newsletter bestellen
Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.