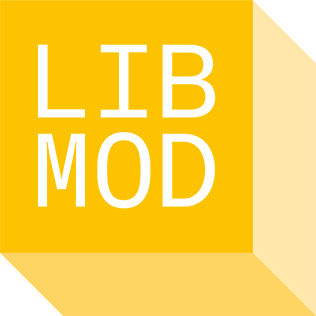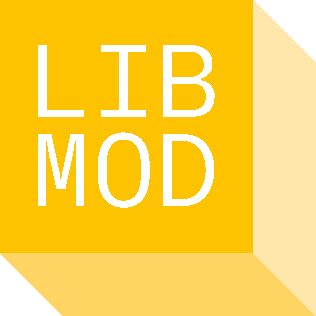Wenn Lebensretter zur Zielscheibe werden

Für die ukrainischen Sanitätstruppen ist der russische Angriffskrieg eine riesige Herausforderung: Dauerbeschuss, systematische Angriffe auf Sanitätspersonal sowie länger werdende Rettungsketten zwingen ihre Soldatinnen und Soldaten zu Improvisation und Reformen. Die Sanitätsdienste westlicher Armeen können viel von ihnen lernen, schreibt Kilian von Sommerfeld.
Mit dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine sind Tod und Verwundung Teil des ukrainischen Alltags geworden. Moderne Waffensysteme wirken tief hinter die Front und treffen häufig zivile und medizinische Einrichtungen. Die medizinische Versorgung von Verwundeten bleibt dadurch fragmentiert und anfällig für Angriffe. Bei Kriegsverletzungen dominieren Explosions- und Schrapnellverletzungen sowie Verbrennungen – vor allem an Gesicht, Armen und Beinen. Besonders bei stark blutenden Verletzungen zählt jede Sekunde.
Die neuen Herausforderungen für das Sanitätswesen im russisch-ukrainischen Krieg entstehen, weil beide Armeen massenhaft ferngesteuerte Kampfdrohnen einsetzen, deren Reichweite sich seit der russischen Vollinvasion 2022 mehr als verdreifacht hat. Neuartige Drohnen, die über ein kilometerlanges Glasfaserkabel gesteuert werden, operieren unabhängig von Funksignalen. Sie können lange in der Luft auf Ziele lauern und sind dabei immun gegen Störsignale.
Evakuierungen und Verwundetentransporte, die in den ersten Monaten der Invasion noch unter dem Schutz der Dunkelheit möglich waren, sind dadurch inzwischen lebensgefährlich geworden. Mit Wärmebild- und Nachtsichttechnik ausgestattete Drohnen machen auch nächtliche Evakuierungen zum tödlichen Spießrutenlauf. Aus den für die Evakuierung entscheidenden Minuten nach der Verwundung werden in einem von Drohnen übersättigten Schlachtfeld oft mehrere Stunden oder Tage. Die Überlebenschancen der Verwundeten nehmen dadurch drastisch ab.
Uneinheitliche Organisationsstrukturen behindern Schlagkraft
Trotz der Gründung eines Medical Force Command nach deutschem Vorbild bleibt der ukrainische Sanitätsdienst organisatorisch uneinheitlich. Zwar orientiert sich der Aufbau zunehmend an NATO-Strukturen – etwa durch die streitkräfteweite Einführung eines eigenständigen Unteroffizier-Korps, das eine zentrale Rolle in Ausbildung, Disziplin und operativem Führen im Gefecht einnehmen soll. Doch diese Reformen greifen bislang nur begrenzt. Ein wesentlicher Grund dafür ist das Fortbestehen sowjetisch geprägter Befehlshierarchien: Viele Offiziere zögern, Verantwortung an Unteroffiziere zu delegieren, die sich mit der Truppe an der Front befinden. Diese Zurückhaltung steht im Widerspruch zum Führungsprinzip westlicher Armeen, bei dem Entscheidungsbefugnisse bewusst auf untere Ebenen verlagert werden, um in kritischen Situationen schnell und zielgerichtet reagieren zu können. Wo dies fehlt, verlangsamt sich die Entscheidungsfindung – mit unmittelbaren Folgen für die Handlungsfähigkeit im Gefecht.
Schnelle Hilfe zählt
Die Rettungskette beginnt am Ort der Verwundung. In den ersten fünf Minuten sterben rund zwei Drittel der rettbaren Verwundeten an unkontrolliertem Blutverlust. Deshalb sind Selbst- und Kameradenhilfe entscheidend. Wird das Tourniquet, eine Abbindevorrichtung für schwerste Verletzungen der Extremitäten, rechtzeitig angelegt, kann der improvisierte Transport zum Verwundetensammelpunkt beginnen – oft über Distanzen von zehn Kilometern und mehr. Durch die technische Weiterentwicklung der Drohnensysteme vergrößert sich auch der Weg des Verwundeten zu einem sicheren Behandlungsort.
An der Sammelstelle übernimmt medizinisch geschultes Personal die Erstversorgung. Anschließend folgt ein weiterer Transport – meist über 15 bis 30 Kilometer – zu einem Stabilisierungspunkt mit ärztlicher Betreuung. Von dort aus geht es dann weiter in Krankenhäuser, die nicht selten 50 bis 200 Kilometer entfernt liegen.
Züge mit einer Kapazität von bis zu 250 Patienten übernehmen einen Großteil dieser Transporte, ergänzt durch Busse. Die Armee verlegt Patienten mit besonders schweren Verletzungen im Einzelfall nach Westeuropa zur Weiterbehandlung.
Medizinische Versorgung ist kriegsentscheidend
Die Kampfkraft jeder Armee im Krieg hängt wesentlich von der medizinischen Rehabilitationsfähigkeit ab. Angesichts hoher Verwundetenzahlen und begrenzter personeller Reserven ist die schnelle Rückführung genesener Soldaten kriegsentscheidend.
Der ukrainische Staat kann den medizinischen Bedarf dieses Krieges nicht allein decken. Bereits 2014 gründete die damals 19-jährige Medizinstudentin Yana Zinkevych das freiwillige Sanitätsbataillon Hospitallers. In einer fünftägigen Basisausbildung bilden Sanitäter Zivilistinnen und Zivilisten zu Lebensrettern aus, die anschließend in zweiwöchigen Rotationen an der Front ihren Dienst leisten.
Sanitäter im Fadenkreuz
Die bloße Präsenz medizinischer Kräfte steigert die Moral der Truppe. Wer weiß, dass im Ernstfall schnelle Hilfe verfügbar ist, kann seinen Dienst unter extremer Belastung besser leisten.
Auch die russische Armee kennt diesen Zusammenhang – und nutzt ihn gezielt aus. Russische Streitkräfte greifen medizinisches Personal systematisch an. Sie beschießen Sanitätsfahrzeuge direkt oder warten gezielt auf den Moment der Verwundetenaufnahme – eine als Double-Tap bekannte Taktik. (So geschehen etwa im April in Sumy). Für die russische Armee spielt es dabei keine Rolle, ob es sich um zivile oder militärische Transporte handelt.
Das humanitäre Völkerrecht und Schutzzeichen wie das Rote Kreuz haben in diesem Krieg ihre Schutzwirkung verloren – im Gegenteil: Die Schutzzeichen werden zu Zielscheiben und ziehen Feuer auf sich. Als Reaktion setzt die Ukraine verstärkt auf Tarnung, gepanzerte Sanitätsfahrzeuge und elektronische Störsysteme zur Abwehr gegnerischer Drohnen. Dennoch bleibt der Preis hoch: Mit rund 30 Prozent Ausfallrate zählen die Sanitäter und Sanitäterinnen zu den am stärksten gefährdeten Kräften im gesamten Militär.
Rettungskräfte schützen
Um Angriffen auf Rettungskräfte entgegenzuwirken, haben die ukrainischen Streitkräfte erste ferngesteuerte Evakuierungsroboter entwickelt. Mit deren Hilfe können Verwundete vom Schlachtfeld gerettet werden, ohne dass Sanitätspersonal sich selbst in Gefahr begeben muss. Aktuell befindet sich die Technologie jedoch noch in einem frühen Entwicklungsstadium – ihr tatsächlicher Einfluss auf das Kriegsgeschehen ist noch begrenzt. Dennoch gilt das Konzept als vielversprechender Schritt hin zu einem sichereren Verwundetentransport.
Im Durchschnitt greift Russland zudem täglich zwei Krankenhäuser an. Diese Angriffe zielen darauf ab, den Druck auf die zivile und militärische Gesundheitsversorgung dauerhaft aufrechtzuerhalten – mit dem strategischen Ziel, die Moral der ukrainischen Bevölkerung zu brechen. Infolge dieser Bedrohungslage haben die ukrainischen Ärzte ihre medizinischen Einrichtungen – wo möglich – unter die Erde verlegt, um Personal und Patienten besser zu schützen.
Sanitätsversorgung am Limit
Die medizinische Versorgung leidet weiterhin unter einem chronischen Mangel an Material und Ausrüstung. Vielen Einheiten fehlt es an grundlegenden Mitteln zur ersten Hilfe, darunter funktionstüchtige Tourniquets und lebenswichtige Medikamente. Um diese Lücken zu schließen, beschaffen sich einzelne ukrainische Armeeeinheiten eigenständig Sanitätsmaterial über Crowdfunding-Initiativen. Die Qualität und Verfügbarkeit der gelieferten Ausrüstung variieren dabei erheblich.
Angesichts begrenzter staatlicher Ressourcen sind Improvisation und private Spenden häufig notwendig, um Verwundete adäquat versorgen zu können. Fehlende Standardisierung sowie der Mangel an zentral gesteuerter Logistik und Materialkontrolle führen dabei zu Versorgungsdefiziten, die sich direkt auf die Behandlungsqualität auswirken. Solange eine systematische Infrastruktur für Beschaffung, Verteilung und Qualitätsprüfung fehlt, bleibt die sanitätsdienstliche Versorgung strukturell anfällig.
Um dies zu verbessern, müssen das Verteidigungsministerium, die medizinischen Führungsebenen und staatliche Logistikstrukturen enger zusammenarbeiten. Ein Beispiel sind minderwert ige Tourniquets, die Beschaffungsbeauftragte durch Unkenntnis ohne zentrale Kontrolle in den Umlauf bringen.
Spezialisierte medizinische Kontrollteams stärken die Qualitätssicherung, und transparente, digitalisierte Beschaffungssysteme wie DOT ermöglichen eine zuverlässige und standardisierte Versorgung. Politische Führung, klare Zuständigkeiten und eine konsequente Umsetzung sind dafür entscheidend.
Strategische Lehren für ein kriegstüchtiges Gesundheitssystem
Medizinische Versorgung ist im Krieg weit mehr als ein humanitäres Anliegen – sie ist eine strategische Ressource. Nur ein System, das Menschen, Material, Ausbildung und Führung ganzheitlich denkt, kann unter permanentem Feinddruck überleben und wirksam handeln.
Trotz großer individueller Einsatzbereitschaft zeigt sich: Ohne verbesserte Prozesse, klarer Verantwortlichkeiten und echter Interoperabilität nach NATO-Vorbild bleiben Defizite wie das fragmentierte Beschaffungssystem bestehen – mit direkten Folgen für Einsatzfähigkeit und Versorgungssicherheit.
Der ukrainische Sanitätsdienst steht dabei aber auch exemplarisch für die Resilienz eines Landes, das täglich ums Überleben kämpft. Seit 2014 wurden Ausbildung, Organisation und Anpassungsfähigkeit kontinuierlich verbessert.
So sehr, dass mittlerweile auch die NATO von den ukrainischen Erfahrungen profitiert und deren Erkenntnisse in Ausbildungskonzepte übernimmt. Auch die Bundeswehr lernt von diesen Erfahrungen – insbesondere in Bezug auf eine breitere sanitätsdienstliche Ausbildung und die Anpassung der Verwundetenlogistik an ein von Drohnen dominiertes Schlachtfeld.
In Zukunft wird viel davon abhängen, wie gut es Armeen gelingt, ein krisenfestes, lernfähiges Sanitätssystem zu schaffen, das der Realität moderner Kriegsführung standhält.
![]()
Verwandte Themen
Newsletter bestellen
Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.