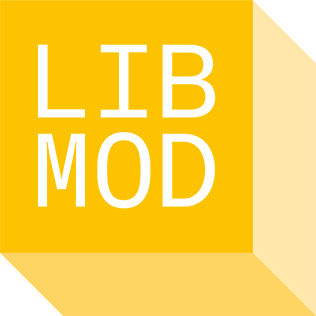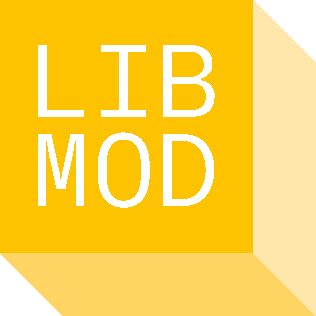Umstrittene Sanktionen gegen politische Rivalen

In der vergangenen Woche hat der Nationale Sicherheitsrat der Ukraine erneut Sanktionen gegen eigene Staatsbürger verhängt. Echte politische Konsequenzen hat das nicht. Dass jedoch zuvor auch Ex-Präsident Petro Poroschenko, politischer Rivale von Wolodymyr Selenskyj und potentieller Präsidentschaftskandidat, mit Sanktionen belegt wurde, sorgte mit Blick auf mögliche Neuwahlen nicht nur in Juristenkreisen für Stirnrunzeln.
Normalerweise sind Sanktionen ein Instrument, das gegen ausländische Staatsbürger eingesetzt wird. Denn Staatsbürgerinnen und Staatsbürger des eigenen Landes kann – erst recht, wenn sie noch nicht ins Ausland geflohen sind – die landeseigene Justiz wegen möglicher Verbrechen verfolgen. Dieser Linie entsprechend wurden auch in der Ukraine längst Sanktionen gegen ausländische Personen und Firmen verhängt, die dem russischen Staat und dem Regime von Wladimir Putin nahestehen. In der vergangenen Woche hat der Nationale Sicherheitsrat unter Vorsitz von Präsident Selenskyj allerdings erneut Sanktionen gegen mehrere ukrainischen Staatsbürger verhängt – eine Praxis, die nicht unumstritten ist.
Dabei geht es weniger um die konkreten Namen, die auf der aktuellen Sanktionsliste stehen. Unter ihnen ist etwa der Blogger Myroslaw Oleschko, der sich einst eher nationalistisch positionierte und Ex-Präsident Petro Poroschenko unterstützte. Oleschko lebt inzwischen im Ausland und setzt sich von dort gegen die Mobilisierung von Wehrpflichtigen in der Ukraine ein. Dass er nun mit Sanktionen belegt wurde, hat politisch keinerlei Konsequenzen.
„Nationaler Kriegserklärer“ mit russischsprachigem Publikum
Etwas anders sieht es im Fall von Oleksij Arestowytsch aus, der eine Zeitlang als externer Berater des ukrainischen Präsidialamts arbeitete – sowohl vor dem russischen Großangriff als auch danach, wobei er ausgerechnet in den Tagen unmittelbar vor dem 24. Februar 2022 ein Rücktrittsschreiben eingereichte. Nach der Ausweitung des russischen Angriffskrieges auf das ganze Land wurde Arestowytsch eine Art „nationaler Kriegserklärer“, der in den sozialen Medien täglich die militärische Lage analysierte – und zwar auf Russisch, weswegen ihm manche schon damals Verrat vorwarfen. Im Januar 2023 trat er von seiner Beratungstätigkeit für das Präsidialamt zurück und verließ unter ungeklärten Umständen das Land.
Als Blogger erreicht Arestowytsch zwar weiterhin ein nennenswertes Publikum, vor allem unter russischsprachigen Menschen – und verbreitet inzwischen eher russlandfreundliche Narrative. Er hat jedoch weder eine ernstzunehmende politische Gefolgschaft in der Ukraine noch könnte er sich als Präsidentschaftskandidat aufstellen lassen, denn dafür müsste er zuvor zehn Jahre lang ununterbrochen im Land gelebt haben.
Insofern ist fraglich, ob es politisch klug war, Arestowytsch mit Sanktionen zu belegen. Der Ex-Berater des Präsidentenbüros, der sich als entschiedener Gegner von Wolodymyr Selenskyj versteht, hält sich überwiegend in den USA auf und pflegt dort Verbindungen zur Republikanischen Partei. Teile von deren Anhängerschaft glauben an das Narrativ, die Ukraine sei keine Demokratie und Selenskyj sei, wie US-Präsident Donald Trump im Februar behauptete, ein „Diktator ohne Wahlen“ – ein Narrativ, das Arestowytsch nun mit der Andeutung, Selenskyj schaffe sich durch Sanktionen politische Kontrahenten vom Hals, mühelos untermauern kann. Auch in seinem Fall halten sich aber die (innen-)politischen Folgen der Entscheidung in Grenzen, ganz anders als bei Petro Poroschenko, gegen den der Nationale Sicherheitsrat im Februar Sanktionen verhängt hatte.
Ex-Präsident mit zweifelhaftem Ruf
Poroschenko war von 2014 bis 2019 Präsident der Ukraine. Dass der Großunternehmer und Oligarch, der einst unter anderem mehrere Fernsehsender besaß, kein Heiliger ist, ist bekannt. Gegen ihn sind mehrere Verfahren anhängig – unter anderem beim Staatlichen Ermittlungsbüro, dem ukrainischen Pendant zum US-amerikanischen FBI –, in denen es überwiegend um angeblichen Staatsverrat geht.
So soll Poroschenko zu Beginn des Krieges in der Ostukraine unter anderem Kohle von den sogenannten Separatisten in den besetzten Gebieten gekauft haben. Der Fall ist kompliziert, denn die Sache ist tatsächlich heikel – doch unter den damaligen Umständen waren Alternativen deutlich teurer und dem Land stand ein harter Winter bevor. Dass der ehemalige Präsident durch die Sanktionen in diesem Jahr zusätzlich zu den laufenden Verfahren auch außergerichtlich sanktioniert wurde, ist ungewöhnlich und führte zu Unmut im Parlament.
Druck auf Selenskyjs politischen Erzfeind
Dass Selenskyj und Poroschenko einander hassen, ist ein offenes Geheimnis, und verantwortlich dafür sind beide Seiten. Die Art und Weise, wie das Team von Poroschenko Selenskyj im Präsidentschaftswahlkampf 2019 als Drogenabhängigen darstellte, war äußerst fragwürdig. Die russische Propaganda griff das Thema anschließend immer wieder dankbar auf.
Im Fall von Poroschenko haben die Sanktionen allerdings tatsächlich politische Konsequenzen. Zwar ist es nicht so, dass Poroschenko aktuell in der Lage wäre, ein Rennen um das Präsidentenamt für sich zu entscheiden. Seine Umfragewerte liegen im mittleren einstelligen Bereich. Als Präsidenten kommen eigentlich nur Amtsinhaber Selenskyj und der beliebte Ex-Armeechef Walerij Saluschnyj in Frage, der heute Botschafter in London ist. Nichtsdestotrotz hat Poroschenko weiterhin eine bemerkenswerte persönliche Anhängerschaft und bleibt de facto Oppositionsführer im Parlament. Dass er bei einer möglichen Wahl gern selbst kandidieren würde, ist offensichtlich.
Sanktionen als unnötiger politischer Schritt
Unterdessen sind die konkreten Inhalte der Sanktionen gegen Poroschenko teilweise absurd. Wenn man die entsprechende Entscheidung des Sicherheitsrates wörtlich nimmt, dürfte er nicht einmal mehr den öffentlichen Nahverkehr oder sein eigenes Handy benutzen. Dass sich Poroschenko nicht als Präsidentschaftskandidat aufstellen lassen dürfte, steht in dem Dokument hingegen nicht ausdrücklich. Allerdings bräuchte er dafür ein Bankkonto, um das nötige Pfand einzuzahlen kann – und das wiederum verbieten die Sanktionen.
Selbst in Kreisen, die Selenskyj nahestehen, sind sich daher viele einig: Dieser Schritt war unnötig. Einerseits schlicht deswegen, weil zwischen Selenskyj und Poroschenko keinerlei wirkliche politische Konkurrenz besteht. Und andererseits, weil die Ukraine gerade angesichts des schwierigen Verhältnisses zu den USA unter Donald Trump mehr denn je politische Einheit braucht.
Zivilgesellschaft muss wachsam bleiben
Schon als im Februar 2021 Sanktionen gegen den prorussischen Politiker und Unternehmer Wiktor Medwedtschuk, einen persönlichen Freund Wladimir Putins, erlassen wurden, stieß das in juristischen Kreisen auf Kritik – obwohl dies damals, kurz vor dem ersten Aufmarsch russischer Truppen an der ukrainischen Grenze, durchaus angemessen erschien. Schließlich kontrollierte Medwedtschuk, den der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU im Frühjahr 2022 festnahm und im Herbst desselben Jahres bei einem Gefangenenaustausch an Russland übergab, über einen Mittelsmann drei prorussische TV-Informationssender mit beachtlicher Quote, die angesichts eines möglichen Großangriffs durch gezielte Desinformation die Bedrohung verstärkten.
Unter den heutigen Umständen aber muss die ukrainische Gesellschaft besonders wachsam sein. Denn es gilt weiterhin: Die Möglichkeiten des Kriegsrechts erlauben juristisch beispielsweise ganz legitim auch eine starke Zensur der Medien. Der ukrainische Staat setzt diese Möglichkeiten bei Weitem nicht voll durch, de facto gilt in der Ukraine heute ein Kriegsrecht light. Dennoch erscheint die Ausweitung der Sanktionsliste als fragwürdig – gerade wenn dies einen ehemaligen Präsidenten und den politischen Erzfeind des heutigen Amtsinhabers betrifft.
![]()
Verwandte Themen
Newsletter bestellen
Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.