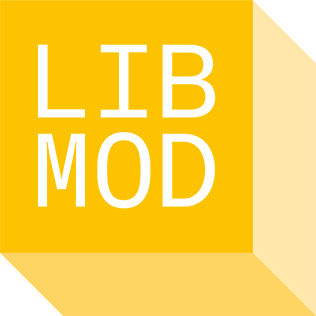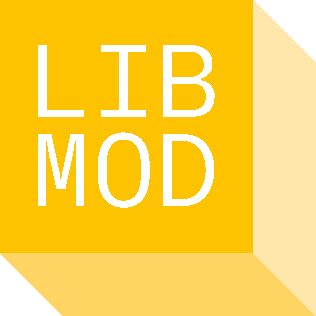Trotz Krieg den Rechtsstaat verteidigen

Es waren die ersten Proteste seit 2022: Mehrere Tausend Menschen gingen in der vergangenen Woche gegen ein Gesetz auf die Straße, das den Kampf gegen Korruption um Jahre zurückgeworfen hätte. Präsident Selenskyj machte daraufhin eine rasche Kehrtwende. Doch die Folgen der Auseinandersetzung werden bleiben, innen- wie außenpolitisch.
Es sind bemerkenswerte Wochen für die ukrainische Innenpolitik. Sie war stets, vorsichtig ausgedrückt, sehr dynamisch – doch nach dem russischen Großangriff waren innenpolitische Differenzen erst einmal in den Hintergrund getreten. Durch sein entschiedenes und mutiges Auftreten zu Beginn des landesweiten Krieges hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj zunächst selbst überzeugte politische Gegnerinnen und Gegner hinter sich vereint. Doch der Eindruck, innenpolitische Fragen hätten seitdem keine Rolle mehr gespielt, täuscht. Selbst 2022 gab es innenpolitische Debatten, wobei sich Kritik damals nicht in erster Linie gegen Selenskyj richtete, sondern gegen Figuren wie seinen mächtigen Bürochef Andrij Jermak.
Spätestens seit Ende 2023 ist jedoch auch öffentliche Kritik am Präsidenten selbst kein Tabu mehr. Wobei die Auseinandersetzung mit US-Präsident Donald Trump Selenskyj innenpolitisch zuletzt noch einmal Aufwind verschaffte. Dem Internationalen Institut für Soziologie in Kyjiw zufolge erklärten im Juni 65 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer, ihrem Präsidenten zu vertrauen – eine ungeachtet des Krieges enorme Zustimmungsrate für ein Land, in dem die Umfragewerte eines Staatsoberhaupts in der Regel rund ein halbes Jahr nach dessen Wahlsieg abstürzen. Zudem herrscht in der Gesellschaft ein breiter Konsens darüber, dass mitten im Krieg unmöglich Neuwahlen organisiert werden können.
Überraschende Proteste
Daran haben auch die Proteste gegen Selenskyj in der vergangenen Woche wenig geändert. Sie richteten sich gegen ein in Rekordzeit verabschiedetes Gesetz, das die Unabhängigkeit des Nationalen Antikorruptionsbüros (NABU) und der Sonderstaatsanwaltschaft zur Korruptionsbekämpfung (SAP) einschränken und diese Behörden dem vom Präsidenten ernannten Generalstaatsanwalt unterstellen wollte. Zwar besteht der harte Kern der Protestierenden aus Vertreterinnen und Vertretern der politisch aktiven Zivilgesellschaft, die Selenskyjs Präsidentschaft überwiegend skeptisch gegenüberstehen. Doch auch – oder insbesondere – ihnen ist klar, dass von einem Wechsel im ukrainischen Präsidentenamt derzeit nur einer profitieren würde: Wladimir Putin.
Nichtsdestotrotz waren die Proteste eine Überraschung. Rund eintausend Menschen versammelten sich am vergangenen Dienstag – dem Tag, an dem das umstrittene Gesetz verabschiedet wurde – in Kyjiw und später auch in anderen Städten, einen Tag darauf waren es bedeutend mehr. Offenbar war Selenskyj davon ausgegangen, die Antikorruptionsbehörden seien in der Bevölkerung wenig beliebt und hatte vor allem deren internationale Strahlkraft unterschätzt.
Im März 2025 hatte das Rasumkow-Zentrum, ein nichtstaatliches Meinungsforschungsinstitut, in einer Studie erklärt, 62 Prozent der Bevölkerung hätten kein Vertrauen in NABU und SAP. Doch diese Zahlen sind eher Ausdruck einer allgemeinen Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den Sicherheitsbehörden. Jenseits eines engen Kreises politisch Engagierter dürften Institutionen wie NABU und SAP sowie das Hohe Gericht zur Korruptionsbekämpfung (WAKS) nur den wenigsten Menschen bekannt sein.
Anti-Korruptionsbehörden langsam und ineffektiv
Kritik an der Arbeit dieser Behörden ist dabei durchaus berechtigt. Sie wurden nach der Maidan-Revolution 2013/2014 bewusst als unabhängige Institutionen gegründet, statt sie in das existierende Strafverfolgungssystem zu integrieren. Denn dieses System galt nicht nur als von Korruption durchsetzt, sondern auch von Agentinnen und Agenten, die für die Russische Föderation spionierten.
NABU und SAP leiteten nach ihrer Gründung mehrfach Verfahren gegen hochrangige Politiker ein und es kam zu spektakulären Festnahmen. Aber nur wenige Fälle schafften es wirklich bis zum finalen Gerichtsprozess, geschweige bis zu einer Verurteilung der Straftäter. Es gibt prominente Verfahren, die sich seit 2016 hinziehen, ohne dass das WAKS je ein rechtkräftiges Urteil gefällt hätte. Dass die Behörden zur Korruptionsbekämpfung alles andere als schnell und effektiv arbeiten, ist also offensichtlich. Doch ihre bloße Existenz ist nicht nur ein deutliches Zeichen auf dem Weg der Ukraine in die EU, sondern auch einer der wesentlichen Fortschritte im Kampf gegen Korruption.
Den jetzt Protestierenden ging es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in erster Linie darum, NABU und SAP als Institutionen zu schützen. Vielmehr dürfte sie der Schock über die Art und Weise auf die Straße gebracht haben, auf die das neue Gesetz zustande kam: Da wurde ein Gesetzentwurf, in dem es um die Suche nach im Krieg vermissten Personen ging, quasi über Nacht umgeschrieben, am selben Tag in zwei Lesungen durch kaum informierte Abgeordnete verabschiedet und noch am Abend vom Präsidenten unterschrieben. Das erinnerte viele nicht nur bitter an die Zeit vor der Maidan-Revolution – sondern ganz klar auch an Putins Russland.
Druck aus der EU zeigt Wirkung
Ob es allein der öffentliche Protest war, der Wolodymyr Selenskyj so schnell zum Umdenken bewegte, lässt sich schwer beantworten. Der Präsident hat dies in seinen jüngsten Auftritten zumindest angedeutet – und tatsächlich ist er in seiner politischen Karriere bisher kaum je so zurückgerudert: Bereits einen Tag nach der Verabschiedung des umstrittenen Gesetzes kündigte er an, dieses noch einmal zu überarbeiten. Den Entwurf, den er daraufhin vorlegte, haben NABU und SAP akzeptiert, auch der zuständige Ausschuss im Parlament unterstützte ihn einstimmig. Ausschlaggebend für die Kehrtwende des Präsidenten waren mit Sicherheit aber auch die klaren Drohungen aus der EU. Denn jede Kürzung finanzieller Hilfe hätte für die Ukraine aktuell katastrophale Folgen.
Unklar bleibt, warum Selenskyj gerade jetzt auf der Annahme eines Gesetzes bestand, bei dem scharfe Reaktionen aus Brüssel und Berlin zu erwarten waren. Der Inlandsgeheimdienst SBU hatte die jüngsten Durchsuchungen bei NABU-Mitarbeitenden mit der „Neutralisierung russischen Einflusses“ begründet. Ob es wirklich nur das war, was Selenskyj zu seinem radikalen Schritt bewegt hat, ist fraglich. Im politischen Kyjiw jedenfalls wird neben dem aufsehenerregenden Korruptionsverfahren gegen Ex-Vizepremier Oleksij Tschernyschow über mögliche Ermittlungen gegen Selenskyjs ehemaligen Geschäftspartner Timur Minditsch spekuliert, der Tschernyschow nahe gestanden haben soll und bis zuletzt großen Einfluss unter anderem auf den ukrainischen Energiesektor hatte.
Egal wie der Kampf um die Unabhängigkeit der Anti-Korruptionsbehörden ausgeht: Er stärkt jene Kritikerinnen und Kritiker Selenskyjs in der Ukraine und im Ausland, die dem ukrainischen Präsidenten seit Längerem autoritäre Tendenzen vorwerfen. Argumente dafür lieferten zum Beispiel rechtlich fragwürdige Sanktionen, die im Februar unter anderem gegen den Ex-Präsidenten und prominenten politischen Gegner Selenskyjs, Petro Poroschenko, verhängt wurden. Die Auseinandersetzungen werden womöglich auch Auswirkungen auf die Arbeit des ukrainischen Parlaments haben, in dem Selenskyjs Partei „Diener des Volkes“ zwar formell die absolute Mehrheit besitzt, de facto aber längst auf die Stimmen anderer Parteien angewiesen ist.
![]()
Verwandte Themen
Newsletter bestellen
Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.