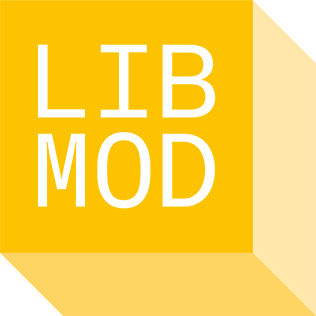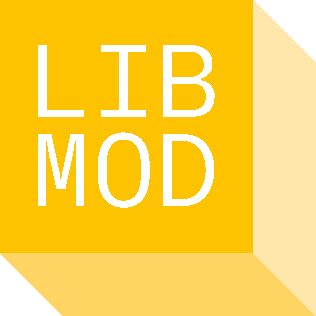Olha Reshetylova: Auf dem Weg zur Ombudsfrau für Militärangehörige

Seit Ende 2024 hat der ukrainische Präsident eine eigene Beauftragte für die Rechte von Militärangehörigen – eine Position, die in Kürze in das Amt einer Militärombudsperson umgewandelt werden soll. Verantwortlich für diese Aufgabe ist die Ex-Journalistin und prominente Menschenrechtlerin Olha Reshetylova, die seit 2014 umfassende Erfahrung an der Front gesammelt hat.
Kurz vor Neujahr stellte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine neue Position in seinem Team vor, die viel darüber aussagt, welche Zeiten die Ukraine gerade durchlebt: die Beauftragte des Präsidenten zu Fragen der Rechte von Militärangehörigen und ihrer Familien. Faktisch handelt es sich um die sogenannte Militärombudsperson, deren Schaffung das Verteidigungsministerium in Kyjiw im Frühjahr 2024 beschlossen hatte. Das dafür nötige Gesetz muss das Parlament noch verabschieden. Es bestehen jedoch wenig Zweifel daran, dass auch diesen Posten die Person übernimmt, die Selenskyj am 30. Dezember mit warmen Worten vorstellte: die aus dem westukrainischen Schytomyr stammende Ex-Journalistin und Menschenrechtlerin Olha Reshetylova (gebürtig: Kobylynska).
„Olha ist eine bekannte und erfahrene ukrainische Menschenrechtlerin“, so das Staatsoberhaupt über Reshetylova. „Sie hat bereits viel für den Aufbau unserer staatlichen Institutionen und die Unterstützung der Ukrainer getan.“ Als ihre Hauptaufgabe sieht Reshetylova es zunächst, das Gesetz über eine Militärombudsperson auszuarbeiten, an dessen Entwurf sie bereits vor ihrer Ernennung mitschrieb.
Zwar wusste sie, dass sie zum Kreis der Kandidatinnen und Kandidaten gehört, die von Selenskyj für die Position in Erwägung gezogen werden – letztendlich wurde sie durch die Personalentscheidung aber doch eher überrascht. Ihre Kontaktdaten veröffentlichte Reshetylova schon jetzt auf Facebook, damit Militärangehörige ihre Beschwerden direkt an sie als Präsidentenbeauftragte richten können. Bereits am ersten Tag bekam sie daraufhin Dutzende von Nachrichten, in denen es unter anderem darum ging, dass Soldaten und Soldatinnen in einigen Einheiten verprügelt worden seien.
Laut Reshetylova soll im neuen Gesetz die Pflicht festgeschrieben werden, auf solche Beschwerden innerhalb von drei bis fünf Tagen zu reagieren. Außerdem ist angedacht, die Amtszeit der Militärombudsperson für vier oder sechs Jahre festzulegen, während die Amtszeit des Präsidenten fünf Jahre dauert. Dadurch sollen Kommandeure und Befehlshaber stärker vor politischer Verfolgung nach einem Regierungswechsel geschützt werden.
Auf keinen Fall solle die Militärombudsperson im übertragenen Sinne mit einem Rohrstock bei den Armeeeinheiten herumlaufen und schlecht arbeitende Kommandeure bestrafen, findet Olha Reshetylova. Vielmehr müsse sie „Strategien und systematische Lösungen erarbeiten, um die Würde von Soldatinnen und Soldaten wiederherzustellen und um den Menschen in den Mittelpunkt der Streitkräfte zu stellen“, betont sie. „Meiner Meinung nach ist dies etwas, was uns grundsätzlich von der russischen Armee unterscheiden wird.“ Optimistischen Einschätzungen Reshetylovas zufolge könnte das neue Gesetzt zur Militärombudsperson schon im März 2025 verabschiedet werden.

Ursprünglich hat Olha Reshetylova Politikwissenschaften an oder Ostroger Akademie im westukrainischen Bezirk Riwne studiert, sich danach aber bald in Kyjiw und im Journalismus wiedergefunden. Unter anderem leitete sie etwa fünf Jahre lang das regionale Korrespondentennetz der bekannten Tageszeitung Den (deutsch: Tag) und war Sonderkorrespondentin des inzwischen geschlossenen russischen Oppositionsmediums Grani.ru in der Ukraine.
Kurz vor der Maidan-Revolution 2013/2014 brachte Reshetylova ihr erstes Kind zur Welt – und entschied sich, nicht mehr in den klassischen Journalismus zurückzukehren. Sie fing als PR-Direktorin bei einem ukrainischen Nischensender an – doch nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim durch Russland und dem Beginn des Krieges in den Gebieten Luhansk und Donezk widmete sie ihr weiteres (Berufs-)Leben der Verteidigung der Menschenrechte.
Zunächst gründete sie die Stiftung Come Back Alive mit, um die damals schwache und vom Krieg überraschte ukrainische Armee durch die Hilfe von Freiwilligen zu unterstützen. Was sie in den nächsten eineinhalb Jahren erlebte, wurde für sie zu einer emotional schweren Erfahrung – nicht allein wegen der russischen Aggression. „Ich habe viel Zeit an der Front verbracht und neben der Tapferkeit unserer Soldaten auch einige unschöne Dinge gesehen“, sagt Reshetylova. Unter anderem wurde ein Freund von ihr, der gegen Schmuggelströme innerhalb der Armee vorgehen wollte, getötet. „Ich sah, wie unsere Einheiten wegen einer Schmuggelroute aufeinander schossen. Ich weiß, wie Zivilisten schikaniert oder freiwillige Helfer vom Militär unter Druck gesetzt wurden.“
Nicht zuletzt deswegen gründete sie später die Medieninitiative für Menschenrechte, eine erfolgreiche NGO, die zu Menschenrechtsverletzungen im Krieg in den Gebieten Luhansk und Donezk recherchierte und zunächst überwiegend journalistische Texte veröffentlichte. „Dann haben wir allerdings verstanden, dass wir über derart viele Informationen über die Lage im Kriegsgebiet, in den besetzten Gebieten, in der Armee und in den Sicherheitsorganen verfügen, dass wir uns nicht mehr nur auf Texte beschränken konnten“, sagt Reshetylova. So stieg die Medieninitiative für Menschenrechte in die Advocacy-Arbeit ein. Später befasste sich die NGO auch mit umfangreichen analytischen Studien – und seit dem russischen Überfall vom 24. Februar 2022 ist die Bedeutung der Dokumentation der Ereignisse durch die Medieninitiative für Menschenrechte kaum zu unterschätzen.
In der ukrainischen Menschenrechtsszene wurde die Ernennung von Olha Reshetylova zur Präsidentenbeauftragten für die Rechte von Militärangehörigen insgesamt sehr positiv aufgenommen. Es gab jedoch auch Kritik: Weil sie einst das Asow-Regiment dafür kritisiert hatte, zu viel Eigen-PR zu betreiben und weil sie nach 2014 in Tschetschenien und auf der besetzten Halbinsel Krim gewesen war. Doch gerade in Bezug auf die letzten beiden Punkte hat sich Reshetylova kaum etwas vorzuwerfen.
Denn auf die Krim reiste sie, um vor Ort zur gewaltsamen Entführung von Menschen zu recherchieren. Und nach Tschetschenien fuhr sie im Frühjahr 2016, um Gerichtsverfahren gegen zwei politische Häftlinge aus der Ukraine zu beobachten. „Das waren sehr gefährliche Reisen. Es hätte gut sein können, dass wir nicht zurückkehren“, erinnert sich Reshetylova. Damals habe fast niemand darüber geredet, wie es aus der Ukraine entführten Zivilpersonen in der Hand russischer Behörden ergehe, darüber hätten sie und ihr Team aufklären wollen. Wenn es jetzt „auch nur die geringste Gelegenheit“ gäbe, Prozesse gegen ukrainische Gefangene vor Ort zu beobachten, schrieb sie auf Facebook, würde sie erneut hinfahren „ohne zu zögern.“
![]()
Verwandte Themen
Newsletter bestellen
Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.