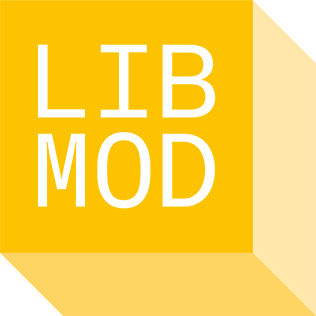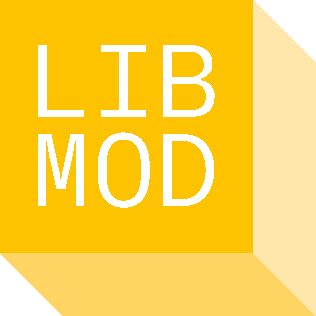Intakte Infrastruktur schützen – statt zerstörte reparieren

Eigentlich ist es ganz einfach: Jeder Euro, der in Militärhilfe und Flugabwehrsysteme investiert wird, rettet Menschenleben und spart Millionenhilfe beim Wiederaufbau und der Reparatur zerstörter Infrastruktur. Doch um das richtige Maß an Unterstützung für die Ukraine wird gerungen.
Beitrag in der Reihe Wiederaufbau im Kriegszustand – Chancen und Risiken
In der Ukraine gibt es zwei Zeitrechnungen: Beinahe 4.300 Tage dauert der Krieg, den Russland 2014 gegen die Ukraine lostrat; mehr als 1.300 Tage sind seit dem russischen Großangriff im Februar 2022 vergangen. Nach der einen wie nach der anderen Rechnung hat sich die Ukraine als bemerkenswert resilient erwiesen. Sie setzt Reformen um und arbeitet erfolgreich mit internationalen Partnern zusammen. Vor allem seit 2022 gehören zu den tragenden Stützen der ukrainischen Widerstandsfähigkeit umfangreiche Militär- und Finanzhilfen internationaler Geldgeber.
Dabei brauchen Taten gemeinhin länger als Worte. Bundeskanzler Olaf Scholz verkündete im Herbst 2022 „der beste Wiederaufbau“ sei einer, „der gar nicht stattfinden“ müsse. Sein Nachfolger Friedrich Merz betont wiederholt, er wolle die Ukraine bei der Luftverteidigung noch stärker unterstützen man müsse die „Raketen und Drohnen stoppen“, die auf die Ukraine abgeschossen werden. Zwischen beiden Aussagen liegen drei Jahre – Jahre, in denen die Ukraine enorme Verluste an Menschenleben und Territorien hinnehmen musste, in denen Infrastruktur zerstört und beschädigt wurde. Die Kosten für den Wiederaufbau werden inzwischen auf mehrere hundert Milliarden Euro geschätzt.
Finanzhilfen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar
Um die Ukraine wieder aufzubauen und nachhaltig resilient zu machen, bedarf es einer ausgewogenen Mischung der drei Bereiche Militärhilfe, Reparaturen und Instandsetzung sowie dem eigentlichen Wiederaufbau. Momentan ist vor allem der Bedarf an Soforthilfen für Reparaturen enorm. Im Folgenden soll es mit besonderem Augenmerk auf Deutschland um alle drei Bereiche der Unterstützung gehen.
Seit Februar 2022 hat die Ukraine von internationalen Partnern Finanzhilfen in Höhe von etwa 152 Milliarden US-Dollar in Form von Darlehen und Zuschüssen zum Staatshaushalt erhalten. Deutschland kam dabei für rund 1,7 Milliarden Dollar auf, weitere 52 Milliarden Dollar flossen aus verschiedenen EU-Töpfen. Zur Einordnung: In Deutschland betrug das Staatsdefizit 2024 mehr als 100 Milliarden Euro (ca. 137 Milliarden US-Dollar).
Finanzhilfen internationaler Partner machen rund die Hälfte des ukrainischen Staatshaushalts aus und decken unter anderem sämtliche Ausgaben im zivilen Bereich. Nach Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft gibt kaum ein Staat mehr als ein Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Hilfe an die Ukraine aus. Deutschland etwa hat der Ukraine seit 2022 Hilfe in Höhe von 0,6 Prozent des jährlichen BIP geleistet – der größte Teil davon Militärhilfen.
Drohnen und Langstreckenwaffen fehlen
Zu den wichtigsten Komponenten militärischer Hilfe gehört die Lieferung von Rüstungsgütern, Ausrüstung und Technik zum direkten Einsatz an der Front. Unmittelbar nach dem russischen Großangriff im Februar 2022 war die militärische Unterstützung durch die EU-Staaten wirkungsvoller, allerdings floss sie eher zäh. Mittlerweile ist der Krieg in einer neuen technischen Phase angelangt, er ist zu einem Krieg der Drohnen und unbemannten Systeme geworden. In diesem Bereich hat die Ukraine innovative Fähigkeiten aufgebaut, die im übrigen Europa ihresgleichen suchen. Ein Erfahrungsaustausch wäre hier für die deutsche Rüstungsindustrie äußerst wertvoll.
Leider fehlt es der Ukraine an Mitteln für eine Skalierung der Produktion vielversprechender Systeme, die dort immer auch gleich im Einsatz getestet werden können. Der Rüstungswettbewerb mit dem Gegner ist rasant. Deshalb ist das dänische Modell der Militärhilfe so relevant: Dänemark kauft Waffensysteme (vor allem Drohnen) von ukrainischen Herstellern für den sofortigen Einsatz. Dadurch erreicht dringend benötigter Nachschub schneller die Front und in der Ukraine werden Arbeitsplätze geschaffen. Die auf diese Weise generierten Steuern stabilisieren den ukrainischen Staatshaushalt und stärken die Resilienz des Landes.
Die ukrainische Armee braucht aber weiterhin auch konventionelle Waffen und Munition. Ein wichtiges Thema dabei sind Langstreckenraketen. Zivilgesellschaftliche Akteure und Politiker:innen haben mit großem Einsatz dafür gekämpft, dass die deutsche Regierung Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine schickt – doch dies scheitert nach wie vor an politischen Bedenken.
Bessere Luftabwehr statt Reparatur von Schäden
Eine zweite wichtige Komponente der Militärhilfe ist die Luftverteidigung. Die Ukraine verfügt nicht über genügend Abwehrsysteme, um Städte und kritische Infrastruktur wie Energieanlagen, Häfen oder Bahnstrecken vor Angriffen zu schützen. 2024 haben russische Drohnen und Raketen 50 Prozent der Energieproduktion lahmgelegt, so dass in den Städten regelmäßig der Strom ausfällt. Milliarden Hrywnja wurden für Reparaturen ausgegeben – eine Summe, die die potenziellen Kosten für die Ausstattung der betroffenen Orte mit Luftverteidigungssystemen bei Weitem übersteigt.
Seit Oktober 2025 hat Russland wieder mit der massiven Zerstörung von Kraftwerken begonnen, erneut müssen Betriebe und Haushalte mit Stromausfällen und ‑abschaltungen zurechtkommen. Deutschland könnte Abhilfe schaffen, indem es langfristig die Lieferung von Luftabwehrsystemen und der dazugehörigen Munition zusichert sowie Wartungsarbeiten übernimmt. Das wäre deutlich günstiger, als die zerstörte Infrastruktur immer wieder neu aufzubauen. Zudem würde es in der deutschen Rüstungsindustrie für volle Auftragsbücher und sichere Arbeitsplätze sorgen.
Auch die EU-Initiative für mehr Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit der Mitgliedsstaaten, Security Action for Europe (SAFE), könnte bei der Unterstützung der Ukraine helfen. Denn es kostet mit Sicherheit weniger, Russland schon in der Ukraine aufzuhalten, als es bis in eines der Länder der Europäischen Union vordringen zu lassen. Bereits jetzt bedroht Russland zivile Flughäfen, wie in München oder Kopenhagen deutlich wurde. Auch der Luftraum der baltischen Staaten und anderer EU-Länder wird immer wieder verletzt. Um in einem modernen Krieg bestehen zu können, muss Europa dringend seinen Verteidigungssektor modernisieren.
Soforthilfe bei der Energieversorgung
Die Ukraine ist bisher nicht durch eine flächendeckende Luftabwehr geschützt, was Verluste und Schäden erheblich minimieren würde. Vor allem Energieanlagen müssten stärker geschützt werden. Dafür braucht die Ukraine Geld ebenso wie Material, insbesondere Schutzzäune und ‑netze oder modulare Lösungen für Strom- und Wärmespeicher – mit anderen Worten: Güter, die auch in Deutschland hergestellt werden.
Ebenfalls sinnvoll wäre die weitere Dezentralisierung der Energieversorgung, vor allem in Bezug auf Heizwärme. Dafür benötigt die Ukraine Technik für den Bau modularer, gasbetriebener Mini-Kraftwerke zur Stromerzeugung und zur Kraft-Wärme-Kopplung. Solche kleinen, dezentral operierenden Erzeuger lahmzulegen, wäre für die russische Armee viel schwieriger. Deutschland könnte über die Kreditanstalt für Wiederaufbau und staatliche Garantien helfen, zusammen mit deutschen Herstellern derartige Lösungen zu finanzieren. So würden ukrainische Städte und Gemeinden gestärkt und gleichzeitig der Export von Energietechnik aus Deutschland angekurbelt.
Erste Schritte hin zum Wiederaufbau
Wie sich das Leben in der Ukraine nach einem Ende des Krieges gestalten wird, hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Dazu gehören vor allem verlässliche Sicherheitsgarantien, wobei Deutschland eine Führungsrolle übernehmen könnte. Erst wenn es belastbare Sicherheitsgarantien gibt, werden Unternehmen wieder in der Ukraine investieren und Geflüchtete zurückkehren. Da Russland auf absehbare Zeit eine Bedrohung bleibt, muss die Ukraine zudem eine schlagkräftige Armee unterhalten und finanzieren.
Für Unternehmen, die in der Ukraine investieren wollen, sind und bleiben Versicherungen wichtig, die auch Kriegsschäden absichern. Das Bundeswirtschaftsministerium hat dafür spezielle Programme für deutsche Firmen aufgelegt. Diese sollten auf deutsch-ukrainische Joint-Ventures ausgeweitet werden.
EU-Beitrittsprozess als Reformmotor
Auch der EU-Beitrittsprozess bereitet den Weg für den Wiederaufbau. Zwischen 2015 und 2019 hat die Ukraine gezeigt, dass sie Reformen zügig umsetzen kann: Die öffentliche Auftragsvergabe und die Dezentralisierung wurden reformiert, was zu mehr Transparenz im Staats- und Verwaltungswesen führte. Seit 2020 wurden digitale Prozesse in der Verwaltung zunehmend digitalisiert, was das Risiko von Korruption und Ineffizienz senken kann.
Eine elektronische Plattform für öffentliche Beschaffungen namens Prozorro erlaubt es heute, die Vergabe staatlicher Aufträge in Echtzeit nachzuvollziehen und so überhöhte Kostenvoranschläge oder Ausgaben ohne wettbewerbsorientiertes Auswahlverfahren früh zu erkennen. Außerdem sind sämtliche Transaktionen der Haushalte auf nationaler und kommunaler Ebene – mit Ausnahme der für Verteidigung und Sicherheit seit 2022 – online einsehbar. 2025 hat die Ukraine zudem den Rechnungshof reformiert, der die öffentliche Haushaltsführung überprüft. Viele dieser Reformen wurden erst durch technische Hilfe aus dem Ausland möglich, wobei auch die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) eine wichtige Rolle spielt.
Ausbildung von Fachkräften fördern
Die beschriebenen Reformen verbessern das Investitionsklima in der Ukraine – nicht nur für deutsche Unternehmen. Die angestrebte EU-Mitgliedschaft des Landes wäre eine weitere Sicherheitsgarantie und ein Anreiz für Investoren. Auf diese Weise würde der Bedarf an direkten Hilfszahlungen für den Wiederaufbau sinken.
Eine Herausforderung ist und bleibt der eklatante Mangel an Fachkräften in der Ukraine. Hier könnte die Erfahrung Deutschlands mit dem dualen System der Berufsausbildung nützlich sein. Die Ukraine muss effektive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Erwachsene schaffen, die es bisher nicht gibt. Wünschenswert wäre zudem, wenn sich Ukrainer:innen, die nach Deutschland geflohen sind, dort Fachkenntnisse und Fähigkeiten aneignen, die später beim Wiederaufbau in der Heimat hilfreich sind.
Hier könnte potenziell zwar ein Interessenkonflikt mit Deutschland entstehen, wo es an gut ausgebildeten Arbeitskräften ebenfalls mangelt. Der Wiederaufbau in der Ukraine würde sich aber sehr viel schwieriger und langwieriger gestalten, sollten Geflüchtete nicht zurückkehren. Deutschland könnte zudem Pilotprogramme zur dualen Ausbildung im Energie- und Bausektor auflegen, deren Zertifikate anerkannt werden. So hätten deutsche Unternehmen bei deutsch-ukrainischen Wiederaufbauprojekten entsprechend qualifiziertes Personal zur Verfügung.
Fazit: Unterstützung der Ukraine hilft allen Seiten
Bei der Entscheidung über ein angemessenes Verhältnis von militärischer Unterstützung und Hilfe beim Wiederaufbau geht es nicht um ein Entweder-Oder, sondern darum, wie sich die Kosten insgesamt minimieren lassen. Jeder Euro, der in Militärhilfe und Flugabwehrsysteme investiert wird, rettet das Leben tausender Ukrainer:innen und spart Millionen beim Wiederaufbau. Sowohl die militärische Unterstützung der Ukraine als auch die Hilfe beim Schutz kritischer Infrastruktur oder beim langfristigen Wiederaufbau bieten deutschen Firmen Chancen auf Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen.
Aus dem Ukrainischen von Beatrix Kersten
Gefördert durch Strategic Communications and Advocacy Lab
![]()
Verwandte Themen
Newsletter bestellen
Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.