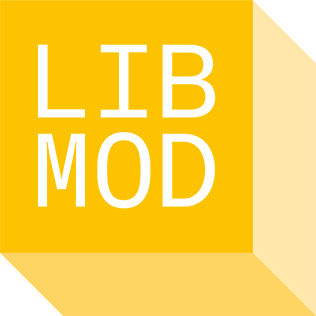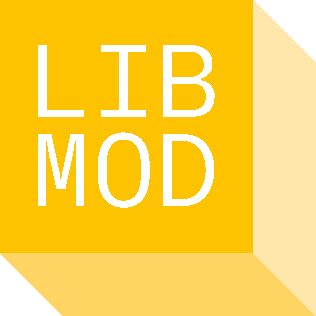Ein Marshallplan für das 21. Jahrhundert

Der Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg bedarf enormer Anstrengungen und Investitionen. Gefragt ist nichts weniger als ein Marshallplan für das 21. Jahrhundert, der die Besonderheiten der ukrainischen Regionen genauso berücksichtigt wie Anforderungen an Transparenz und den verantwortlichen Umgang mit Hilfsgeldern.
Beitrag in der Reihe Wiederaufbau im Kriegszustand – Chancen und Risiken
Der russische Angriffskrieg hat in der Ukraine verheerende Folgen. Der Weltbank zufolge belaufen sich die Kosten für den Wiederaufbau nach drei Jahren Krieg auf knapp 500 Milliarden Euro. Besonders betroffen sind Wohngebäude, etwa 13 Prozent davon sind zerstört oder beschädigt. Mehr als zweieinhalb Millionen Familien haben ihr Zuhause verloren.
Abgesehen von der materiellen Zerstörung hat der Krieg zu einer humanitären Katastrophe geführt. Millionen Menschen mussten ihre Heimat verlassen. Nach UN-Angaben sind etwa 6,9 Millionen Ukrainer:innen ins (zumeist europäische) Ausland geflohen, 3,7 Millionen wurden zu Binnenflüchtlingen im eigenen Land. Diese Zahlen verdeutlichen die Herausforderungen, vor denen die Ukraine und ihre Partner stehen: Ein Wiederaufbau erfordert Ressourcen und Anstrengungen ungekannten Ausmaßes – ähnlich dem Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg, aber in einer Version fürs 21. Jahrhundert.
Wiederaufbau als Investition in die Zukunft Europas
Hilfe beim Wiederaufbau der Ukraine ist für Europa und Deutschland nicht nur eine moralische Pflicht, sondern auch eine strategische Investition in die künftige Stabilität Europas. Eine starke Ukraine mit einer nachhaltigen, prosperierenden Wirtschaft wäre ein robuster Schutzschild an der Ostflanke der Europäischen Union und würde das Risiko einer erneuten militärischen Eskalation durch Russland senken.
Darüber hinaus eröffnet die Integration der Ukraine in den europäischen Wirtschaftsraum Chancen für Europa: Der Wiederaufbau bietet die Möglichkeit, die ukrainische Industrie zu modernisieren. Neue Produktionssparten und Logistikrouten können geschaffen und der europäische Binnenmarkt gestärkt werden. Mittelfristig kann die Ukraine so vom Empfänger- zum Geberland werden, das seinen Teil zu Sicherheit und Wirtschaftswachstum in Europa beiträgt.
Deutschland als wichtigster Partner
Deutschland ist seit dem russischen Großangriff zu einem der wichtigsten Partner der Ukraine geworden. Seit Februar 2022 hat Deutschland der Ukraine militärische, finanzielle und humanitäre Hilfe im Umfang von etwa 44 Milliarden Euro zukommen lassen. Dies umfasst nicht nur moderne Ausrüstung für die ukrainischen Streitkräfte und Material zur Aufrechterhaltung der Energie- und Wasserversorgung, sondern auch direkte Budgethilfen und den Unterhalt für Hunderttausende ukrainische Geflüchtete in deutschen Kommunen.
Langfristiges Ziel ist es, dass die Ukraine unabhängig von Finanzhilfen aus dem Ausland wird und über ihre eigene, sanierte Volkswirtschaft ausreichend Steuereinnahmen erwirtschaftet. Im Idealfall sollte ein Großteil der Geflüchteten in die Heimat zurückkehren können, weil dort ausreichend Arbeitsplätze geschaffen wurden und der Lebensstandard sich verbessert hat. Auf diese Weise würden die Sozialsysteme anderer europäischer Staaten entlastet.
Vorteile für beide Seiten
Wenn sich deutsche Firmen am Wiederaufbau in der Ukraine beteiligen, ist das für beide Seiten von Vorteil: Die Ukraine erhält zeitgemäße Technologien und Investitionen, eine deutsche Firma dafür neue Absatzmärkte und die Chance auf profitable Projekte in einer aussichtsreichen Volkswirtschaft, teilweise sogar mit staatlicher Garantie.
Schon heute gibt es Beispiele für private Investoren aus Deutschland, die sich beim Wiederaufbau engagieren. So arbeitet die Firma Vollert Anlagenbau aus Baden-Württemberg zusammen mit ukrainischen Partnern daran, ein Netz aus Produktionsstätten für den modularen Wohnungsbau zu errichten, um möglichst schnell Wohnungen zu erschwinglichen Preisen zu bauen. Die erste Fabrik in der Region Kyjiw soll bis zu 5.000 Wohnungen pro Jahr fertigen. Das Projekt wird von einem Konsortium deutscher Banken finanziert, wobei deutsche Versicherer sogar die Deckung möglicher Kriegsschäden übernommen haben.
In ähnlicher Weise arbeitet die deutsche Siemens Energy mit ukrainischen Partnern bei der Modernisierung der Energieinfrastruktur (etwa bei unterirdischen Gastanks und Wärmekraftwerken) zusammen, um die Leistungsfähigkeit des ukrainischen Systems zu steigern und seine Integration in die europäischen Netze voranzutreiben.
Regionale Besonderheiten berücksichtigen
Die strategische Planung für den Wiederaufbau nach dem Krieg hat bereits begonnen. Zwischen 2022 bis 2025 fanden jährlich im Sommer hochrangig besetzte Wiederaufbaukonferenzen statt (in Lugano, London, Berlin und Rom). Dort wurden Leitlinien für den Wiederaufbau festgelegt: Die Ukraine selbst soll den Wiederaufbau leiten und anführen, Prozesse transparent gestalten und sowohl internationale Geldgeber als auch die Zivilgesellschaft beteiligen. Dazu erarbeitet die ukrainische Regierung einen Nationalen Erneuerungsplan und internationale Partner helfen dabei, ihn mit Ressourcen zu unterfüttern und die Einhaltung der verabredeten Standards zu überwachen.
Die größte Herausforderung liegt dabei darin, bei der nationalen Planung die Besonderheiten einzelner Regionen zu berücksichtigen. Zwar legt die Regierung in Kyjiw zusammen mit ausländischen Geldgebern landesweite Prioritäten für den Wiederaufbau fest (kritische Energie- und Verkehrsinfrastruktur, Wohnungsbau, Minenräumung, Gesundheits- und Bildungswesen). Doch jede ukrainische Region hat unterschiedliche Bedürfnisse und Potentiale. Wiederaufbauprogramme sollten daher flexibel sein.
So müssen zum Beispiel in frontnahen Regionen vorrangig zerstörte Wohngebäude, Energie- und Wasserversorgungsnetze, Straßen und Brücken wieder aufgebaut werden. Investitionsprojekte wie neue Produktionsstandorte oder Logistikhubs hingegen passen besser in zentral- oder westukrainische Gebiete. Große Industrieunternehmen wie Maschinenbau, Chemie, Erdölverarbeitung sollten in relativ sicheren Regionen angesiedelt werden, wobei – entsprechend modernisierte – Anlagen aus der Sowjetzeit genutzt werden können.
Jede Region kann so ihren eigenen ökonomischen Schwerpunkt entwickeln: im Osten und Süden der agro-industrielle Komplex, Metallindustrie, Hafenlogistik; in der Zentralukraine Maschinenbau, IT und Kreativindustrie; im Westen verarbeitendes Gewerbe und erneuerbare Energien. Jede Region sollte ihre eigenen „Entwicklungsanker“ haben, damit die Menschen nicht massenhaft nach Kyjiw oder ins Ausland abwandern.
Dezentralisierung 2.0: die Rolle der Kommunen
Seit 2014 hatte die Ukraine die Dezentralisierung von Politik und Verwaltung erfolgreich vorangetrieben und durch Reformen Macht und Ressourcen von der Zentralregierung auf Städte und Gemeinden übertragen. Mit der Ausrufung des Kriegsrechts im Februar 2022 übernahmen einen Teil dieser Befugnisse lokale Militärverwaltungen. Die für Oktober 2025 vorgesehenen Kommunalwahlen konnten nicht stattfinden. Um ein Machtvakuum zu vermeiden, verlängerte das ukrainische Parlament die Amtszeit aller Bürgermeister:innen und Gemeinderäte auf unbestimmte Zeit.
Wenn nach Kriegsende wieder Lokal- und Kommunalwahlen stattfinden, dürften zahlreiche neue Politiker:innen ins Amt kommen – unter ihnen vermutlich auch Veteran:innen. Die Kampferfahrung und der stark ausgeprägte Gerechtigkeitssinn vieler Frontsoldat:innen könnte sich als wirksamer Schutz gegen Korruption und Verantwortungslosigkeit im politischen Handeln erweisen.
Föderalismus in Deutschland als Beispiel
Deutschland könnte seine lange Erfahrung gelungener Regionalentwicklung mit der Ukraine teilen. Das deutsche Modell eines föderalen Staatsaufbaus, in dem starke Bundesländer weitreichende Befugnisse haben, ist ein wertvolles Vorbild für die Ukraine. Im Moment bestehen mehr als 190 Städtepartnerschaften zwischen deutschen und ukrainischen Städten – vor dem Krieg waren es nur 76. Auch über solche Kooperationen können Kommunen Wiederaufbauprojekte gemeinsam umsetzen.
Anders als Deutschland ist die Ukraine ein Zentralstaat. Die Regionen haben dementsprechend geringere Machtbefugnisse. In der Regel sind diese auf die Koordination der Arbeit verschiedener staatlicher Stellen beschränkt. Im Zuge der Dezentralisierung jedoch haben gerade Städte beträchtliche Ressourcen und autonome Gestaltungsspielräume hinzugewonnen. Sie müssen sich aktiv einbringen, um regionale Wiederaufbauprojekte erfolgreich umzusetzen. Wenn es darum geht, regionale Schwerpunkte in der wirtschaftlichen Entwicklung auszumachen und aufzubauen, sollten dies hingegen auf der Ebene einer oder mehrerer Regionen geschehen.
Transparenz und öffentliche Kontrolle in Echtzeit
Wer vom Wiederaufbau der Ukraine spricht, warnt meist im selben Atemzug vor Korruption und Veruntreuung. Politik und Gesellschaft in der Ukraine sind sich dessen bewusst, dass Transparenz, der Kampf gegen Korruption und die Beteiligung der Öffentlichkeit Grundpfeiler jedes Wiederaufbauprogramms sind.
In den vergangenen Jahren hat die Ukraine mit einer elektronischen Plattform für öffentliche Beschaffungen namens Prozorro bereits ein durchaus fortschrittliches Instrument für Transparenz geschaffen. Jeder durch die öffentliche Hand vergebene Auftrag wird automatisch online gestellt und kann so von Journalist:innen, Aktivist:innen und internationalen Partnern eingesehen und geprüft werden. Dieses System einer öffentlichen Kontrolle in Echtzeit sollte in vollem Umfang auf Wiederaufbauprojekte ausgedehnt werden.
Wettbewerbsorientierte Auswahl und eine transparente Entscheidungsfindung sind weitere wichtige Eckpfeiler erfolgreichen Wiederaufbaus. Internationale Geldgeber sollten sich gut absprechen und Regierungsvertreter:innen, lokale Verwaltungen, unabhängige Expert:innen und die interessierte Öffentlichkeit frühzeitig einbeziehen. Auswahlkommissionen sollten nach strengen Kriterien vorgehen und Interessenkonflikte vermeiden. Ein solches Vorgehen könnte das Korruptionsrisiko senken, das bei der Implementierung großer Infrastrukturprojekte unweigerlich zunimmt. Die Erfahrung weltweit zeigt, dass Wiederaufbau nach Kriegen oder Naturkatastrophen häufig mit einem Anstieg von Korruption einhergeht, sofern es keine effektiven Kontrollmechanismen gibt.
Mit Blick auf internationale Partner, insbesondere die deutsche Öffentlichkeit, dürften eine strikte Antikorruptionspolitik und das gute Beispiel erfolgreich umgesetzter Vorhaben die besten Argumente dafür sein, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Die deutsche Bevölkerung muss sehen, dass die in den Wiederaufbau ukrainischer Städte und Dörfer investierten Steuergelder konkrete Resultate liefern: sanierte Schulen, Krankenhäuser, neue Fabriken, restaurierte Museen und historische Denkmäler.
Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen
Der Wiederaufbau der Ukraine wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, dauern. Doch er schafft auch die einzigartige Möglichkeit, das Land in allen Bereichen europäischen Standards anzunähern. Für Deutschland und andere westliche Partner ist die Beteiligung an diesem Prozess nicht nur eine moralische Angelegenheit, sondern auch eine langfristige Investition. Denn hier geht es nicht nur um Gerechtigkeit und Hilfe für die Opfer, sondern um den Aufbau einer neuen europäischen Sicherheitsordnung. Eine stabile, prosperierende Ukraine ist der Eckpfeiler für ein erweitertes Europa. Die Ukraine ist ein starker, neuer Markt mit enormen Möglichkeiten für Handel, Investitionen und Kooperation.
Deutschland als einem der stärksten Staaten der Europäischen Union stehen alle Türen offen, um als das Land in die Geschichte einzugehen, das beim Wiederaufbau einer neuen, demokratischen Ukraine den Löwenanteil geschultert hat. Immer wieder wird das mit dem Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg verglichen – doch diesmal würde Deutschland nicht als Empfängerin, sondern als Geberin und als Miturheberin einer neuen Ordnung auftreten.
Schon jetzt geht Berlin mit gutem Beispiel voran und verbindet Solidarität mit Pragmatismus: Deutschland liefert der Ukraine Waffen und Geld für den Kampf, gleichzeitig werden Infrastrukturprojekte geplant, private Investitionen angeschoben und Kriegsrisiken abgefedert. Wenn Ukrainer:innen und Deutsche dieses historische Projekt erfolgreich durchführen, profitieren alle Seiten: Die Ukraine wird gestärkt und kann einen würdigen Platz in der europäischen Familie einnehmen – und Europa bekommt einen verlässlichen Verbündeten, einen erweiterten Markt und mehr Sicherheit über Generationen hinweg.
Aus dem Ukrainischen von Beatrix Kersten
Gefördert durch Strategic Communications and Advocacy Lab
![]()
Verwandte Themen
Newsletter bestellen
Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.