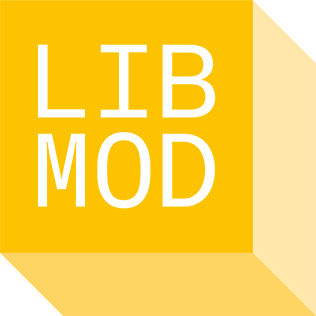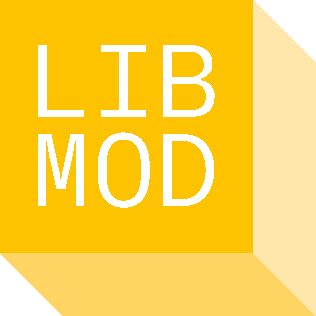Ein diplomatischer Marathon

In den Verhandlungen um ein Rohstoffabkommen zwischen der Ukraine und den USA scheint es voranzugehen: Die in der vergangenen Woche unterzeichnete Absichtserklärung ist für Kyjiw durchaus akzeptabel – ein diplomatischer Erfolg der ukrainischen Regierung und ihrer neuen Verhandlungstaktik. Doch die Skepsis bleibt groß bei einem Thema, das auch innenpolitisch ein hohes Konfliktpotential birgt.
Es bleibt ein zäher diplomatischer Marathon, den die ukrainische Regierung derzeit durchlaufen muss. Die neue US-Regierung um Donald Trump scheint deutlich mehr Druck auf das angegriffene Kyjiw auszuüben als auf den Aggressor Moskau, um so schnell wie möglich und um fast jeden Preis einen Waffenstillstand an der ukrainisch-russischen Front zu erreichen. Gleichzeitig soll ein sogenanntes Mineralienabkommen unterzeichnet werden, das die gemeinsame Nutzung strategisch wichtiger Bodenschätze in der Ukraine regelt. Bei dem Eklat im Weißen Haus am 28. Februar war dieses Vorhaben zunächst in aller Öffentlichkeit gescheitert.
In der vergangenen Woche haben US-Finanzminister Scott Bessent und die ukrainische Wirtschaftsministerin und stellvertretende Regierungschefin, Julia Swyrydenko, endlich eine kurze Absichtserklärung unterschrieben. Nun führte Ministerpräsident Denys Schmyhal in Washington Gespräche über den konkreten Text des Abkommens. Die USA haben im Voraus verlauten lassen, eine Unterzeichnung sei noch Ende dieser Woche zu erwarten. Wie realistisch das ist, bleibt fraglich. Die ukrainische Seite wäre gut beraten, auf Zeit zu spielen. Weil Donald Trump jedoch – bei diesem wie bei allen anderen Themen – auf größtmögliche Schnelligkeit drängt, birgt das allerdings ein erhebliches Risiko.
Kaum aussagekräftig im Detail – aber besser als nichts
Auch wenn die Erklärung, die Bessent und Swyrydenko unterzeichnet haben, im Detail eher nichtssagend ist: Angesichts der momentan mehr als schwierigen Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine ist sie ein diplomatischer Erfolg Kyjiws. Schon für die erste Version des Abkommens, die Ende Februar im Oval Office hätte unterzeichnet werden sollen, hatte die US-amerikanische Seite mehrere aus ukrainischer Sicht vollkommen inakzeptable Vorschläge gemacht. Laut Serhiy Sydorenko, Chefredakteur der Jewropejska Prawda, dem außenpolitischen Ableger der Ukrajinska Prawda, gab es damals zunächst fünf Entwürfe, die aus ukrainischer Sicht allesamt „schlecht bis katastrophal“ waren. Am Ende mussten die US-Amerikaner auf eine für beide Seiten annehmbare Version ausweichen, die – wie die jetzt unterschriebene – wenig mehr als eine Absichtserklärung war.
Nach dem öffentlichen Streit im Oval Office zwischen Donald Trump, seinem Vize J. D. Vance und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hatten die USA den 56-seitigen Entwurf eines Abkommens vorgelegt, das die ukrainische Seite ebenfalls unter keinen Umständen akzeptieren konnte – zumal dessen juristische Qualität durchaus fraglich war. Details über dieses Dokument, datiert vom 23. März, machte unter anderem Jaroslaw Schelesnjak, Abgeordneter der Oppositionspartei Holos, öffentlich.
Schelesnjak betonte mehrfach, er habe den Vertragsentwurf nicht aus ukrainischen Regierungskreisen erhalten. Weitere Angaben zur Quelle seiner Information machte er jedoch nicht. Möglicherweise war zumindest einem Teil der US-amerikanischen Verhandlungsführer damals bewusst, dass eine Vereinbarung in dieser Form keinerlei Chance auf Unterzeichnung hatte. Die geleakten Informationen lösten in der Ukraine eine öffentliche Diskussion aus, die dies auch dem engen Kreis um Donald Trump vor Augen führen musste.
Ein innenpolitisch heikles Thema
Die Idee, Bodenschätze gemeinsam mit anderen Ländern zu nutzen, birgt ohnehin innenpolitischen Sprengstoff. Schon die 2020 verabschiedete Bodenreform, die in der Ukraine – als einem der letzten Länder weltweit – den Privatbesitz von Ackerland und den Handel damit erlaubte, sorgte in Teilen der Gesellschaft für Aufregung und wurde – unter anderem von der russischen Propaganda – als „Ausverkauf der Ukraine“ gebrandmarkt.
Doch der Vorschlag an die USA, Bodenschätze gemeinsam abzubauen und zu nutzen, kam ursprünglich aus der Ukraine und war im vergangenen Jahr auch Teil des sogenannten Siegesplans von Präsident Selenskyj. Hinter ihm steckt mehr als das pragmatische Kalkül, den „Dealmaker“ Donald Trump von einem guten Geschäft zu überzeugen und so dafür zu sorgen, dass er die Ukraine weiter unterstützt und dies auch seiner Kyjiw-skeptischen Stammwählerschaft schmackhaft macht.
Viele Rohstoffvorkommen kann die Ukraine allein gar nicht nutzen
Eine engere Zusammenarbeit mit den USA ergibt für die Ukraine durchaus Sinn. Nach Einschätzung des Weltwirtschaftsforums verfügt das Land über 20.000 Lagerstätten, an denen 116 Arten wertvoller Mineralien vorkommen – darunter nicht nur die viel zitierten Seltenen Erden, sondern auch große Vorräte an Lithium und Titan, die in der Hightech-Industrie stark nachgefragt sind. Doch selbst vor dem russischen Großangriff wurden lediglich an 15 Prozent der ukrainischen Lagerstätten Bodenschätze abgebaut.
Lithium etwa wird in der Ukraine überhaupt nicht gefördert, obwohl das Land über rund 500.000 Tonnen des wertvollen Leichtmetalls verfügt. Zentrales Problem: Die geologischen Erkundungen dauern Jahre und sind teuer. Der ukrainische Staat verfügt nicht über das nötige Geld – und für Investoren, ob aus dem In- oder Ausland, ist die Sicherheitslage zu riskant, zumal viele Mineralien genau in jenen Regionen lagern, in denen heute gekämpft wird.
Eine Zusammenarbeit wäre für beide Seiten von Nutzen
Die Bodenschätze der Ukraine gemeinsam mit den USA und ihren Großkonzernen zu fördern, wäre also theoretisch eine pragmatische und für alle Seiten gewinnbringende Idee. Doch in dem Vertragsentwurf vom 23. März ging es praktisch um den Ausverkauf des Landes. Die USA forderten von der Ukraine, die unter der Regierung von Joe Biden vom US-Kongress bewilligten Hilfsgelder wie einen Kredit zurückzahlen, ohne dafür von Washington die geringste Gegenleistung zu erhalten – ein absolutes No-Go für Kyjiw. Schließlich wurden die Hilfspakete unter der Biden-Regierung ausdrücklich nicht als Kredit, sondern als Militärhilfe für das angegriffene Land verabschiedet.
Überdies wollten sich die USA Anspruch nicht nur auf potenzielle Förderstätten sichern, sondern auch auf die bereits existierende Infrastruktur in den Bereichen Gas, Kohle und Öl. Für die gemeinsamen Unternehmen sollte ein Fonds unter Führung der US-amerikanischen Entwicklungsagentur IDFC gegründet werden, dessen Vorstand aus drei US-amerikanischen und zwei ukrainischen Mitgliedern bestehen sollte – wodurch die USA ein Vetorecht bei allen Entscheidungen des Fonds gehabt hätten.
Geänderte Verhandlungstaktik erfolgreich
Um einen Ausweg aus dieser festgefahrenen Situation zu finden, hat die ukrainische Regierung in jüngster Zeit ihre öffentliche Polemik bezüglich des Abkommens eingestellt und ihre Verhandlungstaktik geändert. Das Verhandlungsteam unter der Führung von Vizeregierungschefin Swyrydenko bestand in erster Linie aus stellvertretenden Ministern und nicht aus prominenten politischen Figuren und führte in den vergangenen Wochen überwiegend sogenannte technische Gespräche.
Zudem griff die Ukraine nicht mehr auf eigene juristische Expertise zurück, sondern beauftragte eine große internationale Kanzlei aus Großbritannien. Diese Strategie scheint – zumindest im ersten Schritt – aufgegangen zu sein. Die unterzeichnete Erklärung mag aus Kyjiwer Sicht nicht in allen Punkten ideal sein. Vielmehr war aus dieser komplizierten Situation jedoch kaum herauszuholen.
Der Elefant bleibt im Raum
Am Ende jedoch bleibt nicht nur die zentrale Frage offen, was das Abkommen konkret beinhalten wird und ob es überhaupt so kurzfristig unterschrieben werden kann. Zum einen muss das ukrainische Parlament eine solche zwischenstaatliche Vereinbarung ratifizieren, was sich als äußerst schwierig erweisen könnte. Denn selbst in der Regierungspartei Sluha narodu (dt.: Diener des Volkes) dürften viele skeptisch auf diese Angelegenheit blicken. Darüber hinaus müssten Dutzende weitere Gesetze zusätzlich geändert werden.
Zum anderen steht der offensichtliche Elefant nach wie vor im Raum: Denn selbst wenn ein tragfähiger Waffenstillstand den Krieg zwischen Russland und der Ukraine eindämmen sollte, ist kaum anzunehmen, dass US-Konzerne große Mengen Geld in ein Gebiet investieren, in dem jederzeit neue Kämpfe ausbrechen könnten. Um dies zu verhindern, bräuchte die Ukraine handfeste Sicherheitsgarantien – und diese werden ihr von Präsident Trump kontinuierlich verweigert.
![]()
Verwandte Themen
Newsletter bestellen
Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.