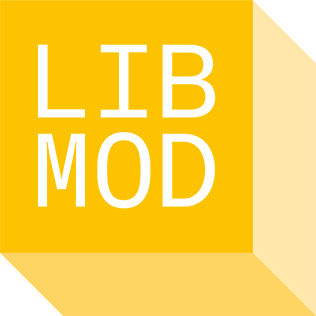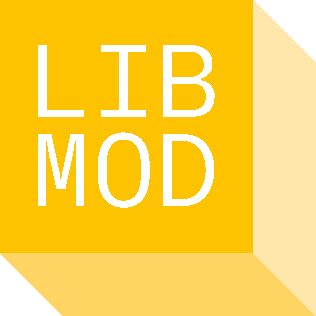Drei Elemente einer europäischen Ukrainestrategie

Auch nach einem Jahr hektischer Diplomatie, haben sich Ende 2025 die Kriegsziele Moskaus und Kyjiws kaum geändert. Europa – zunehmend auf sich alleine gestellt – hat weder ein gemeinsames Kriegsziel noch eine klare Vorstellung davon, wie es zu erreichen wäre.
Was wäre ein akzeptabler Kriegsausgang für die Ukraine und Europa?
Ein erstes Element in einer europäischen Strategie wäre ein Kriegsziel, das europäische Regierungen mit Kyjiw teilen.
Die Ukraine musste sich von Anfang an gegen zwei Arten, den Krieg zu verlieren, wehren. Die erste Möglichkeit ist, dass Russland die Ukraine militärisch unterwirft und sie sich seiner Einflusssphäre einverleibt. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Ukraine sich zwar militärisch behauptet, aber unter dem Druck dieser Anstrengung ihre Demokratie einbüßt. Auch durch eine Erosion demokratischer Strukturen wäre der Ukraine die euro-atlantische Integration verwehrt. Mittelfristig würde das Land wieder in Richtung Moskau driften.
Gegenüber beiden Gefahren hat sich die Ukraine bislang bemerkenswert geschlagen. Anfang 2022 hat sie, mit einer deutlich unterlegenen Armee, russische Truppen vor den Toren Charkiws und Kyjiws vertrieben und im Herbst des ersten Kriegsjahres große Gebiete zurückerobert. Ohne eigene Kriegsschiffe hat die Ukraine die russische Flotte weitgehend aus dem Schwarzen Meer verdrängt. Hinter der Front hat sie sich an ein beständiges Bombardement ihrer Energieinfrastruktur angepasst. Seit 2023 hat die ukrainische Armee trotz riesiger Personalprobleme das russische Vorankommen im Osten und Süden des Landes in eine langsame und sehr kostspielige Abnutzungsschlacht verwandelt.
Während Soldaten an der Front kämpfen, sorgt die ukrainische Zivilgesellschaft – mit westlicher Unterstützung – im Hinterland dafür, dass die Regierung nicht mehr Macht an sich reißt, als es der Verteidigungsfall erfordert. Die Zivilgesellschaft und die Medien wirkten wiederholt als Korrektiv zur kriegsbedingten Machtkonzentration bei der Regierung: Sie halfen etwa im Sommer 2025, die Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden zu erhalten, Korruption im Beschaffungswesen der Armee aufzudecken oder blockierten 2022 ein Gesetz, das im Schatten des Krieges die Kommunen bei der Wohnungsbaupolitik entmachtet hätte.
Für Wladimir Putin ist ein Nachbarland, in dem die Zivilgesellschaft echte Opposition betreibt, ein unbequemes Gegenmodell zu seinem autoritären Stil. Auf welche Weise dieses Demokratieexperiment scheitert – durch eine militärische Niederlage oder durch eine autoritäre Machtübernahme – ist im Kreml nur eine Frage der Kosten. Eine militärische Niederlage herbeizuführen, kostet mehr Geld und mehr Soldatenleben.
Diese hohen Kosten haben den Kreml bisher nicht dazu gebracht, seine Kriegsziele zu revidieren. Die russischen Forderungen waren 2025 dieselben wie im Frühjahr 2022, als russische Truppen noch vor Kyjiw standen. Russland fordert zwar Gebietsabtretungen im Osten der Ukraine, zielt aber vor allem darauf ab, die Souveränität der ganzen Ukraine zu untergraben und eine ständige Mitbestimmung Moskaus in der ukrainischen Politik zu erreichen. So soll die Ukraine künftig nur eine kleine Armee haben dürfen, endgültig auf einen NATO-Beitritt verzichten, und Russland soll bei Sicherheitsgarantien mitentscheiden können.
Wenn es der Ukraine gelingt, sich gegen diese Forderungen durchzusetzen, ihre Souveränität zu wahren und als Demokratie zu überleben, ist der Kriegsausgang ein Erfolg für Kyjiw – und eine Niederlage für Moskau. Ein für die Ukraine akzeptabler Kriegsausgang bemisst sich daher erst einmal nicht in Quadratkilometern, sondern im Ausmaß der politischen Entscheidungen, die sie auch nach dem Krieg souverän treffen kann.
Schrittweise zu einem nachhaltigen Frieden
Ein zweites Element in einer Strategie für die Ukraine wäre ein Verständnis zwischen Kyjiw und seinen europäischen Partnern, welche Schritte zum gemeinsamen Kriegsziel führen. In welcher Reihenfolge sollen Europa und die Ukraine versuchen, einen Waffenstillstand herbeizuführen, ein Friedensabkommen zu verhandeln, Sicherheitsgarantien zu geben und Wahlen abzuhalten?
Der Kreml weiß genau, dass eine demokratisch verfasste Ukraine in der jetzigen Lage nicht direkt zu einem Friedensschluss vorspulen kann. Die von Putin geforderten Zugeständnisse – Gebietsabtretungen und der endgültige Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft – erfordern Verfassungsänderungen. Dafür bräuchten Regierung und Parlament in der Ukraine ein starkes Mandat. Dieses kann nur durch Parlaments- und Präsidentschaftswahlen entstehen, in denen die Bevölkerung zwischen verschiedenen Visionen einer Nachkriegsukraine wählen kann.
Doch solange das Kriegsrecht gilt, sind Wahlen nicht möglich. Um es aufzuheben, bräuchte die Ukraine zumindest einen stabilen Waffenstillstand. Nur ein solcher würde der Regierung erlauben, durch Wahlen ein Mandat für mögliche Zugeständnisse zu erhalten. In der ukrainischen Bevölkerung mangelt es nicht an Kompromissbereitschaft. Umfragen zeigen, dass Ukrainerinnen und Ukrainer zwar nicht zu der von Russland geforderten Kapitulation bereit sind, ein Einfrieren der Frontlinie im Austausch für belastbare Sicherheitsgarantien jedoch viele als akzeptablen Kriegsausgang ansehen. Das heißt, dass mit der richtigen Sequenz von Schritten, die mit einem Waffenstillstand beginnt und mit Wahlen endet, ein Ende der Gewalt erreicht werden könnte. Das geht allerdings nur, wenn auch Russland seine Kriegsziele revidiert.
Eine klare Rollenverteilung
Um einen solchen Fahrplan zum Frieden gegenüber Russland durchzusetzen, muss Europa helfen, die Kosten-Nutzen-Kalkulation des Kremls in diesem Krieg zu verschieben. Moskau trägt bereits hohe Kosten, auch wenn es die ersten drei Kriegsjahre mit einer robusten Wirtschaft überstanden hat. Nun steuert Russland auf eine Stagflation zu, die Wohlstandsverluste für viele Haushalte und prekäre Aussichten für Unternehmen mit sich bringt. Auch wenn das keinen bevorstehenden Kollaps der russischen Wirtschaft bedeutet, ist es ein guter Moment für Europa, die Krise zu beschleunigen und Moskau durch konsequent umgesetzte Sanktionen von seinen Einnahmequellen abzuschneiden.
Ein weiterer Bereich, in dem Europa die Ukraine noch viel stärker unterstützen könnte, sind Tiefenschläge auf Russlands Waffenfabriken, Kriegslogistik und Ölindustrie. Wenn so für Moskau die Kriegskosten steigen, ohne dass das Ziel – die Unterwerfung der Ukraine – näher rückt, wird Moskau irgendwann verhandeln müssen, dann jedoch unter Bedingungen, die von der Ukraine und ihren Partnern bestimmt werden.
Das geht nur, wenn Europa seine Rolle als Partner der Ukraine stärker durch Investitionen in seine Sicherheit unterstreicht und so auch unabhängiger von den zunehmend unberechenbaren USA wird. Ein bedeutender Teil dieser Investitionen sollte in die Ukraine fließen, wo Waffen billiger und schneller hergestellt werden können. In einem Krieg, der rasante technische Entwicklungen vorantreibt, könnte eine engere Zusammenarbeit mit der Ukraine dafür sorgen, dass Innovationen vom Schlachtfeld und Investitionen aus Europa schnell zueinanderfinden. So könnten technische Entwicklungen von der Front rasch in die Massenproduktion übergehen. In der Skalierung der Produktion ist Russlands übermächtige Industrie zurzeit nämlich noch deutlich schneller. Europa würde gleichzeitig Erkenntnisse gewinnen, die in militärische Ausbildung, politische Entscheidungen und Industriepolitik einfließen könnten.
Nicht nur muss Europa seine Rolle als Partner der Ukraine klarer umreißen, es sollte auch deutlicher machen, welche Rolle Russland zukommt. Damit ein Ende der Gewalt nachhaltig bleibt, muss Moskau die Rolle des gescheiterten Aggressors bekommen. Bislang sieht sich der Kreml ganz im Gegenteil als künftige Regionalmacht, in deren Einflussbereich die Ukraine ein unverzichtbarer Bestandteil wäre. Europas Versuche, Russland in die Schranken zu weisen, bleiben meist rhetorisch. Politiker reagieren empört, wenn Moskau ein Vetorecht über Sicherheitsgarantien fordert (wie es das seit den gescheiterten Verhandlungen in Istanbul im Frühjahr 2022 tut), ermöglichen aber durch ihre Vorsicht genau das. Eine Gruppe von mehr als 20 europäischen Ländern, die sich „Koalition der Willigen“ nennt, signalisierte 2025 Bereitschaft, Truppen in die Ukraine zu entsenden – jedoch erst, wenn Putin einem Waffenstillstand zustimmt. Der Kreml legt sein Veto ein, indem er einfach weiterkämpft.
Um Moskau seine Rolle zuzuweisen, braucht Europa mehr Risikobereitschaft. Russland bleibt gefährlich, scheitert aber seit fast vier Jahren daran, die Ukraine zu besiegen. Europa sollte seine Risikokalkulation entsprechend anpassen und die Ukraine vorbehaltloser unterstützen. Mit einem deutlich formulierten Kriegsziel, einem Fahrplan, der dorthin führt, und einer klaren Rollenverteilung in Europa hätten die Regierungen eine gute Argumentationsbasis gegenüber ihren Wählerinnen und Wählern, die dieses Risiko mittragen müssen.
Eine ausführlichere Version dieses Textes erschien im Oktober 2025 im Ukraine Schwerpunktheft von H&G
![]()
Verwandte Themen
Newsletter bestellen
Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.